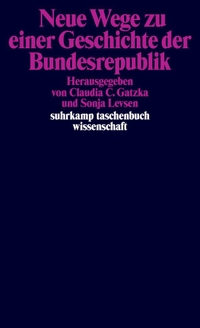Essay
Eine glücklichere Geschichte
Von Joe Paul Kroll
15.08.2016. Für die Deutschen mag die Vergangenheit ein fremdes Land sein. Für Engländer ist sie ein unveräußerliches Gut und seit 1066 ungebrochen eine gute Sache. Zumindest ist das die Geschichte, die sie sich selbst erzählen. Mit dem Brexit führte die Verteidigung der Identität in den Bruch."The past is a foreign country" - "Die Vergangenheit ist ein fremdes Land". Merkwürdig, dass diesen Satz, mit dem L. P. Hartleys Roman "The Go-Between" (1953) beginnt, ausgerechnet ein Engländer geschrieben hat. Denn wirklich verständlich wirkt er nur in Deutschland. Die Vergangenheit scheint sich hier nicht nur vor Zeiten ereignet zu haben, sondern auch in Ländern und Staaten, die mit der heutigen Bundesrepublik, je weiter man zurückblickt, desto weniger zu tun haben. England dagegen scheint sich in vielem gleich geblieben zu sein, und gerade dies macht sein historisches Selbstverständnis aus.
Die Redewendung "time out of mind" bezeichnet umgangssprachlich schlicht eine längst vergessene Vorzeit. Dabei war sie einmal ganz konkret definiert als eine Zeit, die sich dem juristischen Gedächtnis entzog. Im Jahr 1276 wurde der Beginn des gleichsam amtlichen Gedächtnisses auf den 1. Juli 1189, die Thronbesteigung Richards I., fixiert. Wer zu diesem Zeitpunkt bereits Eigentum oder Würden innehatte, musste keinen weiter zurückliegenden Nachweis von deren Rechtmäßigkeit erbringen. Besitz wurde so historisch definiert.
Eine Stunde Null ist dieses Datum gerade nicht, sondern eine willkürlich gesetzte Wegmarke in einer Geschichte, die ob ihrer Kontinuität bereits unüberschaubar zu werden drohte. Englands vielleicht beliebtestes historisches Buch ist "1066 and All That" (1930) von W. C. Sellar und R. J. Yeatman. Der humoristische Klassiker, der mittels Einteilung der Ereignisse in "Good Things" und "Bad Things" den Weg Britanniens zur "Top Nation" nachzeichnet und damit die Whig-Geschichtsschreibung parodiert, enthält genau zwei Daten: 55 v.u.Z., die erste römische Invasion, und 1066, die Eroberung Englands durch die Normannen. Zwei weitere Daten habe man, versichern die Autoren, nach sorgfältiger Prüfung gestrichen, weil sie dem wichtigsten Kriterium nicht hätten standhalten können: "they are not memorable".
In der Tat gehört es zur britischen - nein, doch eher zur spezifisch englischen - Geschichtsmythologie, an Zäsuren arm zu sein. Da gibt es keine Reichsgründungen, Verfassungskonvente oder Nationalversammlungen; keine républiques oder empires muss zählen, wer die Permutationen der Herrschaftsordnung verfolgen will. Von Schottland aus betrachtet sähe die Sache freilich anders aus, aber seit 1066, so die Suggestion, besteht das englische Staatswesen ungebrochen fort. Schocks wie die Reformation fallen nicht ins Gewicht; selbst das republikanische Zwischenspiel (1649 bis 1660) unter Oliver Cromwell konnte rückblickend in eine Geschichte vom Voranschreiten der englischen Freiheit gesehen werden - die "Glorious Revolution" von 1688, in welcher der unliebsame James II. vertrieben wurde, ohnehin.
Solche Kontinuität ist eine Illusion, die sich mühelos einstellt, wenn man die Geschichte nur als eine Abfolge von Monarchen betrachtet. Aber gerade die Anschaulichkeit, mit der sich Geschichte so darstellen lässt - auf einem Lineal oder einem Geschirrtuch etwa, wie man sie im unvermeidlichen Souvenirshop einer mittelalterlichen Burg oder eines herrschaftlichen Anwesens erwerben kann - verleiht ihr eine Evidenz, die in der kollektiven Wahrnehmung über wissenschaftliche Korrekturen und ideologiekritische Mäkeleien triumphiert. Sieht man von großen angelsächsischen Herrschern Alfred dem Großen und Edward dem Bekenner ab, beginnt 1066 beginnt auch die Reihe der zählbaren Könige mit eingängigen Namen: Nicht mehr Egbert, Athelstan oder Æthelred, sondern William I., William II., Henry I., eine Reihe, die sich dereinst, wenn die Monarchie dann noch besteht, mit William V. fortsetzen wird.
Diese Kontinuitätsvorstellung wirkt sich bis in die Verästelungen der kulturellen Selbstwahrnehmung aus, in das Verhältnis zum literarischen Erbe. Nun war der literarische Realismus Englands einer Jane Austen, einer George Eliot im 19. Jahrhundert zweifellos seinem deutschen Pendant überlegen, wie auch keine deutsche Produktion an die entsprechenden Verfilmungen aus britischen Studios heranreicht. Aber ist der Grund, weshalb niemand mehr Gustav Freytag liest - oder auch dessen Zeitgenossen, nach denen im Frankfurter Dichterviertel die Straßen benannt sind -, wirklich nur in der literarischen Qualität oder im peinlichen Antisemitismus zu suchen, wie Tilman Krause unlängst in der Welt fragte.
Liegt es nicht vielmehr daran, dass das Deutschland, von dem Freytag schrieb, uns heutigen ein fremdes Land ist? Auch wenn das Wohnen in Gründerzeitbauten so beliebt ist wie nie, so scheinen sie doch seltsam losgelöst von der Zeit ihrer Errichtung. Schwer zu sagen, aus welcher Fremde sie und die ganzen wilhelminischen Hauptbahnhöfe, die Villen im Jugend- und Heimatstil, angeschwemmt worden sind. Selbst Goethe scheint, zehntausender Verkaufter Exemplare von Rüdiger Safranskis Biografie zum Trotz, in Deutschland viel weniger gegenwärtig zu sein als Shakespeare in England. Zahllose Laienspielgruppen versuchen sich dort an "Hamlet" und "Lear". Wollte man unterdessen das deutsche Nationaldrama anhand der Zahl seiner Aufführungen durch Amateure, insbesondere an Schulen, ermitteln, käme man wohl auf Max Frischs "Andorra" - was eine Kritik nicht der damit verbundenen Vergangenheitsbewältigung sein soll, sondern der Eindimensionalität des Stücks. Allein der deutsche Wagner-Kult hat überraschend alle Verwerfungen überstanden.
Zwar konstituierte sich Deutschland in Ermangelung eines festen Territorialgefüges zunächst gerade literarisch - als reale Sprachengemeinschaft und als dichterische Fantasie - aber dieses imaginierte Deutschland hat zum reellen, politischen Deutschland nur mehr eine schwache Bindung wiedergewinnen können. Wieviel schwächer noch ist die Identifikation mit Kaisern und Königen längst abgewickelter Staatswesen, das Bewusstsein, dass jene etwas mit dem heutigen zu tun haben könnten? Sachsen-Weimar-Eisenach, Pfalz-Zweibrücken, selbst das alte Königreich Bayern und, ohnehin, Preußen: alles "foreign countries". Allenfalls aus Karl dem Großen lässt sich (überdies zweifelhafter) ideeller, aus dem "Kini" Ludwig II. von Bayern touristischer Mehrwert schlagen. Das, mag man einwenden, ist in einem republikanischen Staatswesen kein Verlust. Doch überhaupt scheint der Begriff der Kontinuität scheint in Deutschland negativ besetzt zu sein, wie die Hauptstadtdebatte der 1990er Jahre noch einmal exemplarisch zeigte. Kontinuität ist hier immer verbunden mit der Angst vor der anhaltenden Fruchtbarkeit eines Schoßes, aus dem einst Ungeheuerliches kroch.
Denn auch die Geschichte deutscher Freiheitskämpfe, insbesondere im 19. Jahrhundert, ist weitgehend vergessen. Doch leider ist auch wahr: fehlt es auch an "Good Things" in der deutschen Geschichte nicht, unterlagen sie nur allzu oft. Auch deshalb wird die Geschichte den Deutschen nie mehr ein komfortables Haus sein. Ist sie auch die Kehrseite einer eng fokussierten Geschichtsversessenheit, hat die Geschichtsvergessenheit ein Gutes: Es ist sicherlich ein heilsamer Fortschritt, wenn die kollektive Phantasie einer Nation sich nicht noch hunderte von Jahren später an Hermanns- oder Völkerschlachten erregt. Das deutsche Experiment, die Zeit vor 1914 zur Vorgeschichte zu erklären, aber eben nicht zur sich selbstverständlich in die Kontinuität einfügende "time out of mind", hat etwas Faszinierendes und ist noch lange nicht ausgespielt. Gerade deshalb gilt es aber den Sinn zu schärfen für elementare Unterscheidungen in der historischen Selbstwahrnehmung. Viele Engländer glauben nicht nur, eine glücklichere Geschichte zu haben als die Kontinentaleuropäer. Sie glauben auch, diese Geschichte sei ein unveräußerliches Gut und insgesamt "A Good Thing". Vorwürfe, da handele es sich um eine Selbsttäuschung, kommen dagegen nicht an.
Die Besinnung auf eine beinahe tausendjährige Kontinuität mag auch helfen, den Verlust der Weltgeltung als imperiale Macht zu verschmerzen. So mag im Rückblick das Empire also bloße Episode erscheinen. Bereits der viktorianische Historiker John Robert Seeley prägte den Ausdruck, das Empire sei in "einem Zustand der Geistesabwesenheit" ("a fit of absence of mind") erworben worden. War dies auch als Mahnung intendiert, sich der mit Herrschaft über riesige und entlegene Ländereien verbundenen Verantwortung zu besinnen, so fügt sich der Ausspruch doch in Nachhinein in die Vorstellung einer durch nichts zu erschütternden historischen Kontinuität, eines tiefen Gewässers, dem oberflächliche Bewegungen nichts anhaben können. Ein solches historisches Phlegma zu kultivieren hieße allerdings, die Perspektive der Kolonisierten zu ignorieren. Angesichts der Erschütterung durch die Fremdherrschaft wurde vielfach versucht, an Kontinuitäten anzuknüpfen oder diese wiederherzustellen - etwa in der Benennung des ehemaligen Südrhodesien nach der alten Stadt Simbabwe. Nicht zuletzt die willkürlichen Grenzziehungen in weiten Teilen Afrikas und Asiens haben aber lokale Kontinuitäten nachhaltig zerstört und wirken bis heute nach.
Während sich die Gedenksteine für die in den Kolonien verstorbenen nahtlos in die Zeitlosigkeit der englischen Dorfkirchen fügen, kann sich immerhin anhand einer Statue des Kolonialunternehmers Cecil Rhodes in Oxford eine Geschichtsdebatte entzünden. Doch im Vergleich etwa zu den französischen Traumata von Điện Biên Phủ und Algerien, und ungeachtet der "Schmach von Suez", ist die Abwicklung des britischen Weltreichs für die Großbritannien selbst glimpflich und vor allem ohne innenpolitische Rückwirkungen verlaufen. Es gab, wie der Historiker Perry Anderson für die britische Nachkriegsgeschichte feststellte, "keine dramatische Abrechnung mit der Vergangenheit, nur ein langsames Hinabrutschen in einem Rahmen völliger politischer Stabilität." *
Allerdings hat die Einwanderung der ehemals Kolonisierten oder durch Kolonialismus über den Globus Verstreuten (letzteres zumeist als Sklaven) die vermeintliche Kontinuität eines ethnisch homogenen, "weißen" England beendet und ist mit schweren, teils unbewältigten und mitunter noch weiterschwelenden Konflikten verbunden gewesen. Gerade deshalb ist aber zu vermuten, dass die Vorstellung historischer, institutioneller Kontinuitäten - nicht zuletzt der englischen Rechtstradition, dieses noch vor die normannische Invasion zurückreichenden insularen Sonderwegs - an Bedeutung für die englische Identitätsstiftung eher noch gewinnen wird. Wird solche Kontinuität selbst schon als Glück empfunden, treten Zweifel an Einzelheiten notwendig zurück, werden Brüche eher verdrängt oder relativiert. Selbst wer also, wie der Autor dieser Zeilen, über das Votum für den "Brexit" bestürzt ist, sollte bedenken, dass auch eine nur scheinbar glückliche und in sich stimmige Vergangenheit schwer wiegen kann: Nicht als Last, sondern als eifersüchtig verteidigter Besitz. Es gibt in Deutschland eine Tendenz, die nur zu bereit ist, die Vergangenheit zum Ausland zu erklären und sich in einer postnationalen Zukunft wahlweise aufzuheben oder aufzulösen. Hier beginnt das Unverständnis selbst der europafreundlichsten Engländer.
Joe Paul Kroll
@JoePKroll
* "There was no dramatic reckoning with the past, just a gradual slide within a framework of complete political stability." Perry Anderson, The New Old World. London: Verso, 2009, Seite 139.
Die Redewendung "time out of mind" bezeichnet umgangssprachlich schlicht eine längst vergessene Vorzeit. Dabei war sie einmal ganz konkret definiert als eine Zeit, die sich dem juristischen Gedächtnis entzog. Im Jahr 1276 wurde der Beginn des gleichsam amtlichen Gedächtnisses auf den 1. Juli 1189, die Thronbesteigung Richards I., fixiert. Wer zu diesem Zeitpunkt bereits Eigentum oder Würden innehatte, musste keinen weiter zurückliegenden Nachweis von deren Rechtmäßigkeit erbringen. Besitz wurde so historisch definiert.
Eine Stunde Null ist dieses Datum gerade nicht, sondern eine willkürlich gesetzte Wegmarke in einer Geschichte, die ob ihrer Kontinuität bereits unüberschaubar zu werden drohte. Englands vielleicht beliebtestes historisches Buch ist "1066 and All That" (1930) von W. C. Sellar und R. J. Yeatman. Der humoristische Klassiker, der mittels Einteilung der Ereignisse in "Good Things" und "Bad Things" den Weg Britanniens zur "Top Nation" nachzeichnet und damit die Whig-Geschichtsschreibung parodiert, enthält genau zwei Daten: 55 v.u.Z., die erste römische Invasion, und 1066, die Eroberung Englands durch die Normannen. Zwei weitere Daten habe man, versichern die Autoren, nach sorgfältiger Prüfung gestrichen, weil sie dem wichtigsten Kriterium nicht hätten standhalten können: "they are not memorable".
In der Tat gehört es zur britischen - nein, doch eher zur spezifisch englischen - Geschichtsmythologie, an Zäsuren arm zu sein. Da gibt es keine Reichsgründungen, Verfassungskonvente oder Nationalversammlungen; keine républiques oder empires muss zählen, wer die Permutationen der Herrschaftsordnung verfolgen will. Von Schottland aus betrachtet sähe die Sache freilich anders aus, aber seit 1066, so die Suggestion, besteht das englische Staatswesen ungebrochen fort. Schocks wie die Reformation fallen nicht ins Gewicht; selbst das republikanische Zwischenspiel (1649 bis 1660) unter Oliver Cromwell konnte rückblickend in eine Geschichte vom Voranschreiten der englischen Freiheit gesehen werden - die "Glorious Revolution" von 1688, in welcher der unliebsame James II. vertrieben wurde, ohnehin.
Solche Kontinuität ist eine Illusion, die sich mühelos einstellt, wenn man die Geschichte nur als eine Abfolge von Monarchen betrachtet. Aber gerade die Anschaulichkeit, mit der sich Geschichte so darstellen lässt - auf einem Lineal oder einem Geschirrtuch etwa, wie man sie im unvermeidlichen Souvenirshop einer mittelalterlichen Burg oder eines herrschaftlichen Anwesens erwerben kann - verleiht ihr eine Evidenz, die in der kollektiven Wahrnehmung über wissenschaftliche Korrekturen und ideologiekritische Mäkeleien triumphiert. Sieht man von großen angelsächsischen Herrschern Alfred dem Großen und Edward dem Bekenner ab, beginnt 1066 beginnt auch die Reihe der zählbaren Könige mit eingängigen Namen: Nicht mehr Egbert, Athelstan oder Æthelred, sondern William I., William II., Henry I., eine Reihe, die sich dereinst, wenn die Monarchie dann noch besteht, mit William V. fortsetzen wird.
Diese Kontinuitätsvorstellung wirkt sich bis in die Verästelungen der kulturellen Selbstwahrnehmung aus, in das Verhältnis zum literarischen Erbe. Nun war der literarische Realismus Englands einer Jane Austen, einer George Eliot im 19. Jahrhundert zweifellos seinem deutschen Pendant überlegen, wie auch keine deutsche Produktion an die entsprechenden Verfilmungen aus britischen Studios heranreicht. Aber ist der Grund, weshalb niemand mehr Gustav Freytag liest - oder auch dessen Zeitgenossen, nach denen im Frankfurter Dichterviertel die Straßen benannt sind -, wirklich nur in der literarischen Qualität oder im peinlichen Antisemitismus zu suchen, wie Tilman Krause unlängst in der Welt fragte.
Liegt es nicht vielmehr daran, dass das Deutschland, von dem Freytag schrieb, uns heutigen ein fremdes Land ist? Auch wenn das Wohnen in Gründerzeitbauten so beliebt ist wie nie, so scheinen sie doch seltsam losgelöst von der Zeit ihrer Errichtung. Schwer zu sagen, aus welcher Fremde sie und die ganzen wilhelminischen Hauptbahnhöfe, die Villen im Jugend- und Heimatstil, angeschwemmt worden sind. Selbst Goethe scheint, zehntausender Verkaufter Exemplare von Rüdiger Safranskis Biografie zum Trotz, in Deutschland viel weniger gegenwärtig zu sein als Shakespeare in England. Zahllose Laienspielgruppen versuchen sich dort an "Hamlet" und "Lear". Wollte man unterdessen das deutsche Nationaldrama anhand der Zahl seiner Aufführungen durch Amateure, insbesondere an Schulen, ermitteln, käme man wohl auf Max Frischs "Andorra" - was eine Kritik nicht der damit verbundenen Vergangenheitsbewältigung sein soll, sondern der Eindimensionalität des Stücks. Allein der deutsche Wagner-Kult hat überraschend alle Verwerfungen überstanden.
Zwar konstituierte sich Deutschland in Ermangelung eines festen Territorialgefüges zunächst gerade literarisch - als reale Sprachengemeinschaft und als dichterische Fantasie - aber dieses imaginierte Deutschland hat zum reellen, politischen Deutschland nur mehr eine schwache Bindung wiedergewinnen können. Wieviel schwächer noch ist die Identifikation mit Kaisern und Königen längst abgewickelter Staatswesen, das Bewusstsein, dass jene etwas mit dem heutigen zu tun haben könnten? Sachsen-Weimar-Eisenach, Pfalz-Zweibrücken, selbst das alte Königreich Bayern und, ohnehin, Preußen: alles "foreign countries". Allenfalls aus Karl dem Großen lässt sich (überdies zweifelhafter) ideeller, aus dem "Kini" Ludwig II. von Bayern touristischer Mehrwert schlagen. Das, mag man einwenden, ist in einem republikanischen Staatswesen kein Verlust. Doch überhaupt scheint der Begriff der Kontinuität scheint in Deutschland negativ besetzt zu sein, wie die Hauptstadtdebatte der 1990er Jahre noch einmal exemplarisch zeigte. Kontinuität ist hier immer verbunden mit der Angst vor der anhaltenden Fruchtbarkeit eines Schoßes, aus dem einst Ungeheuerliches kroch.
Denn auch die Geschichte deutscher Freiheitskämpfe, insbesondere im 19. Jahrhundert, ist weitgehend vergessen. Doch leider ist auch wahr: fehlt es auch an "Good Things" in der deutschen Geschichte nicht, unterlagen sie nur allzu oft. Auch deshalb wird die Geschichte den Deutschen nie mehr ein komfortables Haus sein. Ist sie auch die Kehrseite einer eng fokussierten Geschichtsversessenheit, hat die Geschichtsvergessenheit ein Gutes: Es ist sicherlich ein heilsamer Fortschritt, wenn die kollektive Phantasie einer Nation sich nicht noch hunderte von Jahren später an Hermanns- oder Völkerschlachten erregt. Das deutsche Experiment, die Zeit vor 1914 zur Vorgeschichte zu erklären, aber eben nicht zur sich selbstverständlich in die Kontinuität einfügende "time out of mind", hat etwas Faszinierendes und ist noch lange nicht ausgespielt. Gerade deshalb gilt es aber den Sinn zu schärfen für elementare Unterscheidungen in der historischen Selbstwahrnehmung. Viele Engländer glauben nicht nur, eine glücklichere Geschichte zu haben als die Kontinentaleuropäer. Sie glauben auch, diese Geschichte sei ein unveräußerliches Gut und insgesamt "A Good Thing". Vorwürfe, da handele es sich um eine Selbsttäuschung, kommen dagegen nicht an.
Die Besinnung auf eine beinahe tausendjährige Kontinuität mag auch helfen, den Verlust der Weltgeltung als imperiale Macht zu verschmerzen. So mag im Rückblick das Empire also bloße Episode erscheinen. Bereits der viktorianische Historiker John Robert Seeley prägte den Ausdruck, das Empire sei in "einem Zustand der Geistesabwesenheit" ("a fit of absence of mind") erworben worden. War dies auch als Mahnung intendiert, sich der mit Herrschaft über riesige und entlegene Ländereien verbundenen Verantwortung zu besinnen, so fügt sich der Ausspruch doch in Nachhinein in die Vorstellung einer durch nichts zu erschütternden historischen Kontinuität, eines tiefen Gewässers, dem oberflächliche Bewegungen nichts anhaben können. Ein solches historisches Phlegma zu kultivieren hieße allerdings, die Perspektive der Kolonisierten zu ignorieren. Angesichts der Erschütterung durch die Fremdherrschaft wurde vielfach versucht, an Kontinuitäten anzuknüpfen oder diese wiederherzustellen - etwa in der Benennung des ehemaligen Südrhodesien nach der alten Stadt Simbabwe. Nicht zuletzt die willkürlichen Grenzziehungen in weiten Teilen Afrikas und Asiens haben aber lokale Kontinuitäten nachhaltig zerstört und wirken bis heute nach.
Während sich die Gedenksteine für die in den Kolonien verstorbenen nahtlos in die Zeitlosigkeit der englischen Dorfkirchen fügen, kann sich immerhin anhand einer Statue des Kolonialunternehmers Cecil Rhodes in Oxford eine Geschichtsdebatte entzünden. Doch im Vergleich etwa zu den französischen Traumata von Điện Biên Phủ und Algerien, und ungeachtet der "Schmach von Suez", ist die Abwicklung des britischen Weltreichs für die Großbritannien selbst glimpflich und vor allem ohne innenpolitische Rückwirkungen verlaufen. Es gab, wie der Historiker Perry Anderson für die britische Nachkriegsgeschichte feststellte, "keine dramatische Abrechnung mit der Vergangenheit, nur ein langsames Hinabrutschen in einem Rahmen völliger politischer Stabilität." *
Allerdings hat die Einwanderung der ehemals Kolonisierten oder durch Kolonialismus über den Globus Verstreuten (letzteres zumeist als Sklaven) die vermeintliche Kontinuität eines ethnisch homogenen, "weißen" England beendet und ist mit schweren, teils unbewältigten und mitunter noch weiterschwelenden Konflikten verbunden gewesen. Gerade deshalb ist aber zu vermuten, dass die Vorstellung historischer, institutioneller Kontinuitäten - nicht zuletzt der englischen Rechtstradition, dieses noch vor die normannische Invasion zurückreichenden insularen Sonderwegs - an Bedeutung für die englische Identitätsstiftung eher noch gewinnen wird. Wird solche Kontinuität selbst schon als Glück empfunden, treten Zweifel an Einzelheiten notwendig zurück, werden Brüche eher verdrängt oder relativiert. Selbst wer also, wie der Autor dieser Zeilen, über das Votum für den "Brexit" bestürzt ist, sollte bedenken, dass auch eine nur scheinbar glückliche und in sich stimmige Vergangenheit schwer wiegen kann: Nicht als Last, sondern als eifersüchtig verteidigter Besitz. Es gibt in Deutschland eine Tendenz, die nur zu bereit ist, die Vergangenheit zum Ausland zu erklären und sich in einer postnationalen Zukunft wahlweise aufzuheben oder aufzulösen. Hier beginnt das Unverständnis selbst der europafreundlichsten Engländer.
Joe Paul Kroll
@JoePKroll
* "There was no dramatic reckoning with the past, just a gradual slide within a framework of complete political stability." Perry Anderson, The New Old World. London: Verso, 2009, Seite 139.
1 Kommentar