Bücher der Saison
Autobiografische Erzählungen
Eine Auswahl der interessantesten, umstrittensten und meist besprochenen Bücher der Saison.
05.11.2018. Das deutsche Schamdreieck, eine französische Soziologie sexueller Gewalt, italienische Männlichkeit und amerikanischer Bildungswille. Wie stark prägt einen die Herkunft? Und wie stark lässt man sich von ihr bestimmen? Mit dieser Frage beschäftigen sich mehrere Bücher, die Erinnerung, soziologische Analyse, Roman und private Geschichtserzählung verbinden. Da wäre zuerst Daniela Dröschers "Zeige deine Klasse" zu nennen. Dröscher analysiert, inspiriert von Didier Eribons "Rückkehr nach Reims", ihre Herkunft aus einem zwar bürgerlichen, doch bildungsfernen ländlichen Milieu ("Drei Ds" bezeichnet Dröscher als ihr Schamdreieck: "dicke Mutter, Dorf, Dialekt") und den schwierigen Milieuwechsel ins Bildungsbürgertum. Die Rezensenten haben das mit Interesse gelesen. Allerdings geht es in dem Buch nicht um die Frage, wie Klassengrenzen in Deutschland abgebaut oder leichter überwunden werden könnten, es ist eher ein literarisch anspruchsvoller Text über soziale Grenzen, meint SZ-Kritikerin Verena Mayer. In der taz bewundert Frank Schäfer die Autorin für ihre Offenheit. In der FAZ fragt sich Hannah Bethke, ob es die Sprösslinge gebildeter Kreise tatsächlich so viel leichter haben.
Wie stark prägt einen die Herkunft? Und wie stark lässt man sich von ihr bestimmen? Mit dieser Frage beschäftigen sich mehrere Bücher, die Erinnerung, soziologische Analyse, Roman und private Geschichtserzählung verbinden. Da wäre zuerst Daniela Dröschers "Zeige deine Klasse" zu nennen. Dröscher analysiert, inspiriert von Didier Eribons "Rückkehr nach Reims", ihre Herkunft aus einem zwar bürgerlichen, doch bildungsfernen ländlichen Milieu ("Drei Ds" bezeichnet Dröscher als ihr Schamdreieck: "dicke Mutter, Dorf, Dialekt") und den schwierigen Milieuwechsel ins Bildungsbürgertum. Die Rezensenten haben das mit Interesse gelesen. Allerdings geht es in dem Buch nicht um die Frage, wie Klassengrenzen in Deutschland abgebaut oder leichter überwunden werden könnten, es ist eher ein literarisch anspruchsvoller Text über soziale Grenzen, meint SZ-Kritikerin Verena Mayer. In der taz bewundert Frank Schäfer die Autorin für ihre Offenheit. In der FAZ fragt sich Hannah Bethke, ob es die Sprösslinge gebildeter Kreise tatsächlich so viel leichter haben.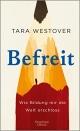
 Verlässt man sich auf die Kritiken, spielen die Verletzungen bei Dröscher eine größere Rolle als der letztlich doch gelungene Aufstieg. Bei der Amerikanerin Tara Westover ist das anders. Sie kommt aus denkbar ärmlichen Verhältnissen in den Bergen Idahos, ihre Eltern sind strenggläubige Mormonen, die Bildung rundweg ablehnen. In "Befreit" erzählt sie, wie sie es aus diesen stickig-engen Verhältnissen erst an die Schule und dann an die Universität schaffte. Ihr Buch ist vor allem ein Plädoyer für Bildung, die den Menschen auch "aus seiner nicht selbst verschuldeten Unmündigkeit" befreien kann, so FAZ-Rezensentin Ursula Scheer. Was es Westover gekostet hat, von der unbedarften Schülerin, die im Kunstunterricht fragt, was Holocaust sei, bis nach Cambridge zu kommen, kann man nur ahnen. Dass der Bruch mit Herkunft und Eltern Einsamkeit, aber vor allem Befreiung bedeutete, daran hat Scheer nach der Lektüre keinen Zweifel. In der SZ hofft Christoph Bartmann dringend auf "Nachahmungstäter". Ein sehr schönes Interview mit Westover findet man im Tagesspiegel. Auch Alma M. Karlins "Ein Mensch wird" ist die Autobiografie einer Kämpferin. 1889 im slowenischen Teil Österreich-Ungarns mit einer halbseitigen Lähmung galt sie den Ärzten und ihrer Umwelt als geistig behindert. Doch das "Zusammenkratzerl", wie sie sich selbst nennt, mauserte sich zur Bestsellerautorin und Weltreisenden. Ihre 1931 verfasste Autobiografie endet 1919. Bis dahin haben ihr Humor, ihr Lebenswille und ihre Intelligenz die Kritikerinnen in der taz und im Blog Bücherfrauen stark beeindruckt.
Verlässt man sich auf die Kritiken, spielen die Verletzungen bei Dröscher eine größere Rolle als der letztlich doch gelungene Aufstieg. Bei der Amerikanerin Tara Westover ist das anders. Sie kommt aus denkbar ärmlichen Verhältnissen in den Bergen Idahos, ihre Eltern sind strenggläubige Mormonen, die Bildung rundweg ablehnen. In "Befreit" erzählt sie, wie sie es aus diesen stickig-engen Verhältnissen erst an die Schule und dann an die Universität schaffte. Ihr Buch ist vor allem ein Plädoyer für Bildung, die den Menschen auch "aus seiner nicht selbst verschuldeten Unmündigkeit" befreien kann, so FAZ-Rezensentin Ursula Scheer. Was es Westover gekostet hat, von der unbedarften Schülerin, die im Kunstunterricht fragt, was Holocaust sei, bis nach Cambridge zu kommen, kann man nur ahnen. Dass der Bruch mit Herkunft und Eltern Einsamkeit, aber vor allem Befreiung bedeutete, daran hat Scheer nach der Lektüre keinen Zweifel. In der SZ hofft Christoph Bartmann dringend auf "Nachahmungstäter". Ein sehr schönes Interview mit Westover findet man im Tagesspiegel. Auch Alma M. Karlins "Ein Mensch wird" ist die Autobiografie einer Kämpferin. 1889 im slowenischen Teil Österreich-Ungarns mit einer halbseitigen Lähmung galt sie den Ärzten und ihrer Umwelt als geistig behindert. Doch das "Zusammenkratzerl", wie sie sich selbst nennt, mauserte sich zur Bestsellerautorin und Weltreisenden. Ihre 1931 verfasste Autobiografie endet 1919. Bis dahin haben ihr Humor, ihr Lebenswille und ihre Intelligenz die Kritikerinnen in der taz und im Blog Bücherfrauen stark beeindruckt. Und schließlich noch zwei literarische Texte, die sich mit prägenden Erlebnissen auseinandersetzen. Die hochgepriesene französische Autorin Annie Ernaux erzählt in ihrer "Erinnerung eines Mädchens" von ihrem ersten Liebhaber. Kennen lernte sie ihn 1958 in einer Ferienkolonie. Sie kam aus kleinen Verhältnissen, arbeitete als Betreuerin. Er ist ein paar Jahre älter, ihr Chef und für die brave Annie völlig überwältigend. Sie schläft mit ihm - oder überlässt sich ihm, eine offenbar brutale Erfahrung - wird umgehend sitzengelassen und dem allgemeinen Spott preisgegeben. Das ist in Kurzform die Geschichte, die sie stark geprägt hat. Das Mädchen von damals ist verschwunden, weshalb Ernaux von ihr auch nicht in der Ich-Form spricht, sondern in der dritten Person. Im Dlf beschreibt ein bewundernder Christoph Vormweg ihre Darstellung als "steten Wechsel von analytischer Distanzierung und Ganz-nah-Heranzoomen", heiß und kalt, unpersönlich und aufwühlend. Für den tief beeindruckten SZ-Kritiker Alex Rühle ist Ernaux auch, weil sie die Bedeutung der Klasse so fein erfasst, mit diesem Buch auf der Höhe der Zeit. Und NZZ-Kritiker Paul Jandl liest darin eine umfassende Soziologie sexueller Gewalt, die das Heraufbeschwören von Lektüren, Chansons und Tagebucheinträgen sowie eine vor- und rückwärts laufende Suche nach Bildern miteinschließt.
Und schließlich noch zwei literarische Texte, die sich mit prägenden Erlebnissen auseinandersetzen. Die hochgepriesene französische Autorin Annie Ernaux erzählt in ihrer "Erinnerung eines Mädchens" von ihrem ersten Liebhaber. Kennen lernte sie ihn 1958 in einer Ferienkolonie. Sie kam aus kleinen Verhältnissen, arbeitete als Betreuerin. Er ist ein paar Jahre älter, ihr Chef und für die brave Annie völlig überwältigend. Sie schläft mit ihm - oder überlässt sich ihm, eine offenbar brutale Erfahrung - wird umgehend sitzengelassen und dem allgemeinen Spott preisgegeben. Das ist in Kurzform die Geschichte, die sie stark geprägt hat. Das Mädchen von damals ist verschwunden, weshalb Ernaux von ihr auch nicht in der Ich-Form spricht, sondern in der dritten Person. Im Dlf beschreibt ein bewundernder Christoph Vormweg ihre Darstellung als "steten Wechsel von analytischer Distanzierung und Ganz-nah-Heranzoomen", heiß und kalt, unpersönlich und aufwühlend. Für den tief beeindruckten SZ-Kritiker Alex Rühle ist Ernaux auch, weil sie die Bedeutung der Klasse so fein erfasst, mit diesem Buch auf der Höhe der Zeit. Und NZZ-Kritiker Paul Jandl liest darin eine umfassende Soziologie sexueller Gewalt, die das Heraufbeschwören von Lektüren, Chansons und Tagebucheinträgen sowie eine vor- und rückwärts laufende Suche nach Bildern miteinschließt. Es gibt auch eine männliche Scham, davon erzählt der 1956 geborene italienische Autor Edoardo Albinati in seinem autobiografischen Roman "Die katholische Schule" Er ging in den Siebzigern in Rom auf eine katholische Privatschule für Jungen. Aus dieser Schule kamen 1975 die Täter, die zwei Mädchen entführten, vergewaltigten und folterten. Eine starb dabei. Um dieses - wahre! - Ereignis kreist Albinatis Buch. Er "changiert zwischen Psychogrammen, Essays, regelrechten Erzählungen und Gegenwartssplittern", erklärt Maike Albath im Dlf Kultur über diesen "faszinierender Roman-Koloss", der zugleich Bildungsroman, Gesellschaftsanalyse und Männlichkeitsstudie sei. Im Interview für die SZ erzählt Albinati ihr, wie sehr Männlichkeit im Italien der Siebziger noch von faschistischen Vorstellungen geprägt war: "Es gab das Ideal des perfekten, gesunden, unversehrten Körpers und keine Möglichkeit der Angleichung an das, was wir waren. Wir waren dauerfrustriert: Du wirst nie Steve McQueen sein."
Es gibt auch eine männliche Scham, davon erzählt der 1956 geborene italienische Autor Edoardo Albinati in seinem autobiografischen Roman "Die katholische Schule" Er ging in den Siebzigern in Rom auf eine katholische Privatschule für Jungen. Aus dieser Schule kamen 1975 die Täter, die zwei Mädchen entführten, vergewaltigten und folterten. Eine starb dabei. Um dieses - wahre! - Ereignis kreist Albinatis Buch. Er "changiert zwischen Psychogrammen, Essays, regelrechten Erzählungen und Gegenwartssplittern", erklärt Maike Albath im Dlf Kultur über diesen "faszinierender Roman-Koloss", der zugleich Bildungsroman, Gesellschaftsanalyse und Männlichkeitsstudie sei. Im Interview für die SZ erzählt Albinati ihr, wie sehr Männlichkeit im Italien der Siebziger noch von faschistischen Vorstellungen geprägt war: "Es gab das Ideal des perfekten, gesunden, unversehrten Körpers und keine Möglichkeit der Angleichung an das, was wir waren. Wir waren dauerfrustriert: Du wirst nie Steve McQueen sein."
Kommentieren








