Siddhartha Mukherjee
Das Gen
Eine sehr persönliche Geschichte
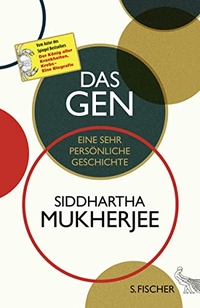
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2017
ISBN 9783100022714
Gebunden, 768 Seiten, 26,00 EUR
ISBN 9783100022714
Gebunden, 768 Seiten, 26,00 EUR
Klappentext
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Bischoff. Warum sind wir so, wie wir sind? Was ist in der Familie angelegt, was erworben? Was können wir selbst bestimmen? Pulitzerpreisträger Siddhartha Mukherjee erzählt die Geschichte der Entzifferung des Mastercodes, der unser Menschsein bestimmt. Von den Erbsenkreuzungen Mendels bis zur neuesten Gen-Bearbeitungs-Methode CRISPR schreibt Mukherjee den Roman einer wissenschaftlichen Suche und verwebt ihn mit der Geschichte seiner Familie.
BuchLink. In Kooperation mit den Verlagen (Info)
Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 31.08.2017
Rezensentin Josephina Mayer lernt die finsteren Seiten der Genforschung im neuen Buch von Siddharta Mukherjee kennen. Denn jenseits von "idyllischen Klostergärten" liest die Kritikerin hier auch von Joseph Mengeles Experimenten an Zwillingen oder dem Fall der 21-jährigen Amerikanerin Carrie Buck, die einer eugenischen Zwangssterilisation unterzogen wurde. Davon abgesehen erzählt ihr der New Yorker Arzt und Krebsforscher die persönliche Geschichte seiner Familie, in der mehrere Fälle von Schizophrenie und manischer Depression auftraten und die er einmal mehr geschickt mit historischen Ereignissen zu verknüpfen weiß. Insbesondere lobt die Rezensentin, dass Mukherjee darauf aufmerksam macht, dass wir mutierten Genen auch "Vielfalt und Lebendigkeit" zu verdanken haben.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.07.2017
Rezensent Thomas Weber hat Siddharta Mukherjees Geschichte des Gens mit Gewinn gelesen. Dass der Arzt und Autor einmal mehr auf die Mischung von Historischem, Persönlichem und Wissenschaftlichem setzt, gefällt dem Kritiker gut - wenngleich er gestehen muss, dass ihm der erste Teil des Buch, der die Historie der Genetik behandelt, ein wenig zu unscharf gerät: Die Geschichte von Mendel bis zu den heutigen Erkenntnissen medizinischer Genetik wird als "unvermeidliche Entwicklung zur Wahrheit" präsentiert und Gregor Mendel zum "einsamen" Revolutionär stilisiert, bemängelt Weber. Umso gebannter liest der Rezensent jedoch den zweiten Teil, in dem der Autor aus der Perspektive des Arztes Einblicke in Gegenwart, Zukunft und Grenzen der modernen Genetik gewährt. Und wenn Mukherjee schließlich am Beispiel seiner beiden an Schizophrenie erkrankten - und außergewöhnlich talentierten - Onkel erläutert, dass die Homogenisierung und Normalisierung durch Gentherapien nicht nur vorteilhaft ist, kann der Kritiker das Verdienst dieses Buches gar nicht genug würdigen.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deThemengebiete
Kommentieren








