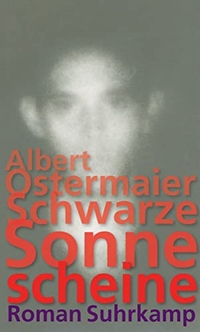Schwarze Sonne scheine
Roman
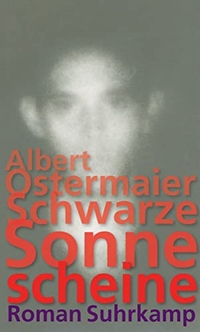
Suhrkamp Verlag, Berlin 2011
ISBN
9783518422205
Gebunden, 287 Seiten, 22,90
EUR
Klappentext
Unauflöslich und ungeheuerlich erscheint das Dilemma, das dem zweiten Roman von Albert Ostermaier seine aufs äußerste gehende existentielle, moralische und gesellschaftliche Dimension verleiht. Ein junger Mann, aufgewachsen in einem katholischen Internat in Bayern, der sein Leben darauf ausgerichtet hat, Schriftsteller, Dichter zu werden, muss sich entscheiden zwischen sicherem Tod und ungewissen Überleben, für das er sich allerdings zwei völlig unbekannten Menschen überlassen muss. Eine ausgewiesene prominente Ärztin stellt ihm die Diagnose, er leide an einer nur von ihr diagnostizierbaren tödlichen Krankheit, die eine sofortige Therapie im amerikanischen Texas erfordere. Der väterliche Mentor, ein katholischer Priester, rät, der Ärztin zu vertrauen und in die USA zu reisen.
Wie soll sich der angehende Schriftsteller entscheiden? Andere Diagnosen einholen, obwohl sie laut Ärztin die Krankheit nicht aufspüren können? Dem Rat der Eltern folgen und sich sofort dem Krankenhaus ausliefern? Statt dessen rekapituliert er sein Leben und die Ereignisse, die zu dieser dramatischen Situation geführt haben. Diese Recherche der vergangenen und verlorenen Jahre eines jungen Mannes weitet sich durch die detailgetreue, nüchterne Schilderung der Internatsjahre zu einem umfassenden, erschütternden Panorama moralisch-politischer Strukturen im Süden Deutschlands, in dem der einzelne wenig, die Kirche alles zählt. Und nur wer sich gegen die miteinander verzahnten Hierarchien stellt, ist, wie Albert Ostermaier, in der Lage, souverän vom Leiden, dem eigenen wie dem anderer, einfühlsam und zugleich distanziert, spannend und mitreißend, anklagend und erklärend zu erzählen.
Rezensionsnotiz zu
Neue Zürcher Zeitung, 18.08.2011
Rezensent Samuel Moser bescheinigt Albert Ostermaiers zweitem Roman "viel Kalkül" und erkennt darin die Absicht zu "raffinierter Suggestion". Suggeriert werden soll, so die Interpretation Mosers, dass es sich bei dem gegen Ende des Romans zum "wahren Künstler" geläuterten Protagonisten Sebastian um niemand Geringeren als Ostermaier selbst handle - und bei dem von Sebastian nun zu erwartenden meisterhaften Roman um - nun ja: "Schwarze Sonne scheine". Das ist dem Rezensenten dann doch etwas zu dick aufgetragen. Zumal ihm außerdem die Sprache Ostermaiers als übermäßig bildhaft und schrankenlos "pathetisch" aufstößt. Dass die erzählte Geschichte - eine unter Narkose beziehungsweise im Traum stattfindende Selbsterkundung des Protagonisten - den Roman in die Nähe des Surrealismus rücke, lässt der Kritiker als Entschuldigung für seine sprachlichen und inhaltlichen Dammbrüche nicht gelten. Und so will Moser nicht verhehlen, dass sich ihm die Lektüre dieser Traumerzählung als Albtraum dargeboten hat.
Rezensionsnotiz zu
Die Tageszeitung, 02.07.2011
Rezensent Rene Hamann scheint bei der Lektüre von Albert Ostermaiers Künstlerroman "Schwarze Sonne scheine" geradezu Höllenqualen durchlitten zu haben. Mehrmals warf er das Buch "an die Wand", nur gutes Zureden seines Redakteurs brachte ihn dazu weiterzulesen, bekennt er. Ostermaier versuche, den schlimmen "sprachlichen Einfluss" der katholischen Kirche darzustellen, das Ergebnis sei leider kitschig-pathetischer Sprachschwulst, so der Hamann. Vielleicht sei der Einfluss der katholischen Kirche für Ostermaier von hoher biografischer Bedeutung, der Rezensent, der schon immer wusste, dass die katholische Kirche "böse" ist, lernt hier nichts neues.
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Rundschau, 04.06.2011
Peter Michalzik ist ganz einfach hingerissen von diesem Buch: die ebenso "traurig-schöne" wie "absurd-komische" Geschichte dieses Künstlerromans von Albert Ostermaier erscheint ihm so unglaublich, dass sie einfach wahr sein muss. Ein katholischer Abt will einen seiner jungen Schützlinge so fest an sich binden, dass er sogar so weit geht, eine falsche Ärztin zu beauftragen, die diesem eine Todesdiagnose ausstellt. In "Schwarze Sonne scheine" geht es um Todesangst, Hypochondrie, die Leiden einer Künstlerexistenz und nicht weniger als um das ganze Leben, so etwa auch in der Episode des krebskranken, verträumten Blümchens, der sich in sein Haus zurückgezogen hat, um dort ganz allein Wagners Ring der Nibelungen zu inszenieren. Es ist aber in besonderem Maße Ostermaiers Sprache, die den Rezensenten zu seiner Lobeshymne hinreißt: Für Michalzik ist der Autor ein "überschwänglicher Barde", der in "neobarockem Sprachüberfluss" voller Wärme "die Welt umarmt".
Rezensionsnotiz zu
Die Zeit, 01.06.2011
Ein Hymne singt Ijoma Mangold auf diesen Roman Albert Ostermaier, im Ton so emphatisch wie man sich das Werks selbst wohl auch vorstellen muss. Denn, wie Mangold schreibt, mit seinem "Mut zum Pathos, zum Narzissmus und zur Metapherntrunkenheit" liefere Ostermaier das katholische Gegenstück zu unserer trockenen "literarischen Bauhaus-Zeit". Die Geschichte, die der Autor erzählt und die der Rezensent als wahre Begebenheit liest, ist folgende: Der junge Sebastian wendet sich einem charismatischen Benediktiner-Abt zu, der ihn zunächst in seiner Dichterwerdung ermuntert, dann aber auf eine böse Fährte führt: Er schickt ihn zu einer Ärztin, die bei Sebastian mir nichts dir nichts eine tödliche Krankheit diagnostiziert und ihn damit in einen Strudel aus Todesangst und Ruhmsucht stürzt. Die vermeintliche Ärztin entpuppt sich als Betrügerin, als einzige nicht geblendet von dieser Verkörperung des Katholizismus, die Heilung verspricht, wo keine Not tut, ist Sebastians protestantische Freundin. Nicht klar scheint zu sein, ob der Abt in das perfide Spiel eingeweiht war oder nicht, als umso brutaler empfindet Mangold sein Schweigen.
Rezensionsnotiz zu
Süddeutsche Zeitung, 23.05.2011
Durchaus beeindruckt ist Rezensent Christoph Schröder von Albert Ostermaiers zweitem Roman "Schwarze Sonne scheine", auch wenn er ihn nicht rundum gelungen findet. Er liest die Geschichte um den Sohn aus gutem Haus, der Jura studieren soll, aber lieber Dichter werden möchte, als eine Geschichte von "Ohnmacht und Abhängigkeit". Außerdem geht es um eine Auseinandersetzung mit Gott und um die Angst vor dem Tod. So meint der junge Mann, von einem väterlichen Freund, dem charismatischen Abt Silvester, und einer Ärztin getäuscht, er müsse bald sterben. Schröder erwähnt, dass das Werk brisante autobiografische Bezüge hat, die ihn allerdings weniger interessieren. Der Roman bietet seines Erachtens keine leichte Kost. Die wütende, verzweifelte Sprache, die auch vor Pathos nicht zurückschreckt und teilweise - bewusst - die Grenzen zum Kitsch überschreitet, scheint ihm immer wieder anstrengend, andererseits entwickelt sie für ihn einen starken Sog. Sein Fazit: ein Roman, "der Ernst macht und ernst zu nehmen ist".
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.05.2011
Dies ist ein Roman, der viel will und nicht zuletzt darum verstört. Findet Rezensentin Felicitas von Lovenberg, die auf autobiografische Hintergründe verweist, das Erfundene vom Erlebten zu trennen in ihrer Kritik jedoch nicht unternimmt. Ein junger Mann, erzogen im Kloster, Wahlsohn des Abts, studiert Jura, fühlt sich aber zum Dichter berufen. Eine Ärztin - die keine ist, empfohlen hat sie der Abt - diagnostiziert beim Helden eine tödliche Krankheit. Der glaubt ihr, wirft sich dem kommenden Tod so verzweifelt wie sprachmächtig an die Brust und wird, als er erfährt, dass ihm der Ziehvater in der Angelegenheit ganz übel mitspielt, schrecklich desillusioniert. "Überbordend, ekstatisch, verschwenderisch" gebärdet sich die Sprache des Dichters (und also auch die des Autors). Unübersehbar ist der Respekt von Lovenbergs vor dem Hochhinauswollen Albert Ostermeiers mit seinem Roman. Es scheint fast so, als käme es aufs Gelingen - von der "Grenze zum Kitsch" ist die Rede - im jeweiligen Einzelfall der Metapher und der dahinjagenden Syntax so sehr dann gar nicht mehr an.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.de
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)