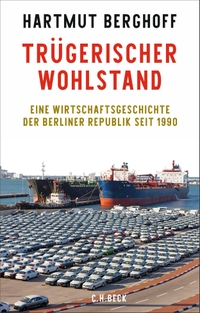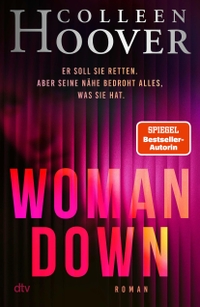ein wort gibt das andere
Man kann auch Kunst dazu sagen
Exkurse ins Berliner Geistesleben. Von Elke Schmitter
12.11.2025. Eine Veranstaltung des Poetry Projects versammelte sieben Flüchtlinge und Hanna Schygulla im Max Liebermann Haus in Berlin. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak - Kulturen, in denen das literarische Wort vor allem ein poetisches ist - und im Falle der Oberschlesierin Schygulla ein musikalisches.Dieser November macht seinem Ruf bislang alle Ehre, und um noch ein wenig Licht zu schnappen, nehme ich den Bus. Hinter mir bespricht eine Gruppe junger Männer im schönsten Fränkisch das Abendprogramm, während vor mir einer jener Berliner Sätze fällt, an denen man, auch wenn alles dunkel ist, immer weiß, in welchem Kiez man sich befindet: "Hier hatte ich den besten Döner meines Lebens", "Da rechts habe ich mein Hörgerät gekauft", das sind so Orientierungen. Bei "Wo sind wir hier genau?" ist man ziemlich sicher auf der langen Strecke durch den Tiergarten, in der das Schloss Bellevue, das Haus der Kulturen der Welt und, je nach Kurvenlage, die Kuppel des Reichstagsgebäudes durch die Kronen der Bäume schimmern wie in einem Märchen von Hans Christian Andersen. Abgründig, fern, und doch eine Verheißung.
Im einem Sandsteingebäude von Josef Paul Kleihues gleich neben dem Brandenburger Tor treffen sich an diesem Abend vor Publikum sieben Menschen, die vor zehn Jahren hier angekommen sind, in dieser Stadt, die so eine Verheißung war. "Etwas Besseres als den Tod finden wir überall", so heißt es im deutschen Märchen, und daran haben sie sich gehalten, weil sie es mussten. Denn wer will schon weg von zuhause, wenn er zwölf oder dreizehn Jahre alt ist, sich in einem Lastwagen verstecken, auf schwankende Boote steigen, mutterseelenallein? Kahel Kashmeri hat es gemacht. "Wir fuhren in einem alten Peugeot, die Luft stickig vom Atem der Angst." Nach etlichen Monaten kam er nach Berlin und konnte "zum ersten Mal wieder tief atmen, als hätte die Stadt selbst mir Zuflucht geschenkt". Im Aufnahmelager traf er auf Leute, die Anteil nahmen. Und Fragen stellten. Die er nicht beantworten konnte. Nicht nur wegen der Sprache, sondern auch wegen des Unaussprechlichen. "Die Schlepper sahen in uns Jungen nur die kleinen Körper, die sie ausbeuten konnten. Noch heute schmerzt mich die Scham."
Die Journalistin Susanne Koelbl, die mit "The Poetry Project" zu dieser Veranstaltung geladen hat, kennt sich in den Ländern aus, die Kashmeri und die vielen anderen verlassen haben. Afghanistan, Syrien, Irak, das sind Kulturen, in denen das literarische Wort vor allem ein poetisches ist. Ein Gesang, ein Gedicht, ein Ausdruck der Seele, der Schutz und Form gibt und anders schwingt als der prosaische Satz, in dem alles auf Festlegung zielt. Vielleicht um so mehr, als er, für die Geflüchteten, Behördensprache ist. So trägt es Rojin Namer vor: "Nennt mich integriert / Ich bin das Kind, / dessen Zukunft in Antrag A3 stand, / handschriftlich / in Druckbuchstaben / eingereicht mit Zittern / gesegnet mit Warten". Sie floh, eine syrische Kurdin, im Alter von zwölf aus Irak nach Deutschland, allein. Und ist eine derer, die das "Poetry Project" zum Sprechen brachte. Praktisch: in Workshops, in geschützten Räumen mit Papier und Stift, Tee und Geduld. Im Symbolischen: indem das, was im Bewusstsein flackert oder in der Erinnerung wühlt, eine Gestalt finden kann und so an diffuser Macht verliert. Wie Menschen das eben praktizieren, seit sie ihre Ängste, ihre Träume und das Unbegreifliche auf Höhlenwände malen, in weichen Ton kratzen oder in Strophen singen. Nach der Umarmung die älteste Therapie der Welt; man kann auch Kunst dazu sagen.
Nun studiert Namer an der Humboldt-Universität; sie gehört zu den Geflüchteten, die seit einem Jahrzehnt zum Stadtbild gehören; in der Beschäftigungsquote, wie Koelbl in feiner Präzision bemerkt, "fünf Punkte unter der Gesamtbevölkerung". Namers Poetry-Project-Kollege Shazamir Hataki, inzwischen 25, ist heute Notfallmediziner an der Charité. Nicht nur hin und wieder, sondern immer wieder kommt es vor, dass seine Hilfe zurückgewiesen wird, weil seine Hände "die eines Kanaken sind": Dieser Abend ist keine Parade des reinen Gelingens und der Glückseligkeit.
Aber einer der auch sanften Überraschungen. Hanna Schygulla ist da, nicht nur als grande dame des Films, sondern auch als ehemaliges Flüchtlingskind. Keine drei Jahre zählte sie, als die Mutter sich mit ihr aus Oberschlesien nach München rettete; von der Flucht ist ihr nichts mehr in Erinnerung. Aber ein Satz, den sie später sagte, als sie einmal allein die Straße entlangspazierte und ein Passant sie fragte "Ja Butzerle, wo g'hörst du denn hin?" - "Zu mir."
Schygulla singt Lieder von Friedrich Hollaender, von Max Colpet und Franz Waxman, alle drei jüdische Flüchtlinge. Ihre Stimme oszilliert zwischen Verlorenheit und Lakonie, Sentiment und Pointe, die ambivalente Mischung vieler Chansons der Weimarer Republik. "Jetzt gehe ich allein, durch eine große Stadt / und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat". Der Flügel, auf dem Felix Raffel sie begleitet, steht im ehemals jüdischen Haus Liebermann, wo wir alle im zweiten Obergeschoss versammelt sind. 1943 wurde die Villa zerbombt, in den 1990er Jahren wieder aufgebaut. Nun ist sie ein Kulturzentrum und im Besitz der Familie Quandt, deren Vermögen im Nationalsozialismus erheblich gewachsen war. Sie ist wesentlicher Anteilseigner von BMW, in dessen Motorradwerk in Spandau Kahel Kashmeri heute arbeitet.
The Poetry Project, Ein Abend mit Hanna Schygulla; Liebermann Haus, 10.11.2025
Im einem Sandsteingebäude von Josef Paul Kleihues gleich neben dem Brandenburger Tor treffen sich an diesem Abend vor Publikum sieben Menschen, die vor zehn Jahren hier angekommen sind, in dieser Stadt, die so eine Verheißung war. "Etwas Besseres als den Tod finden wir überall", so heißt es im deutschen Märchen, und daran haben sie sich gehalten, weil sie es mussten. Denn wer will schon weg von zuhause, wenn er zwölf oder dreizehn Jahre alt ist, sich in einem Lastwagen verstecken, auf schwankende Boote steigen, mutterseelenallein? Kahel Kashmeri hat es gemacht. "Wir fuhren in einem alten Peugeot, die Luft stickig vom Atem der Angst." Nach etlichen Monaten kam er nach Berlin und konnte "zum ersten Mal wieder tief atmen, als hätte die Stadt selbst mir Zuflucht geschenkt". Im Aufnahmelager traf er auf Leute, die Anteil nahmen. Und Fragen stellten. Die er nicht beantworten konnte. Nicht nur wegen der Sprache, sondern auch wegen des Unaussprechlichen. "Die Schlepper sahen in uns Jungen nur die kleinen Körper, die sie ausbeuten konnten. Noch heute schmerzt mich die Scham."
Die Journalistin Susanne Koelbl, die mit "The Poetry Project" zu dieser Veranstaltung geladen hat, kennt sich in den Ländern aus, die Kashmeri und die vielen anderen verlassen haben. Afghanistan, Syrien, Irak, das sind Kulturen, in denen das literarische Wort vor allem ein poetisches ist. Ein Gesang, ein Gedicht, ein Ausdruck der Seele, der Schutz und Form gibt und anders schwingt als der prosaische Satz, in dem alles auf Festlegung zielt. Vielleicht um so mehr, als er, für die Geflüchteten, Behördensprache ist. So trägt es Rojin Namer vor: "Nennt mich integriert / Ich bin das Kind, / dessen Zukunft in Antrag A3 stand, / handschriftlich / in Druckbuchstaben / eingereicht mit Zittern / gesegnet mit Warten". Sie floh, eine syrische Kurdin, im Alter von zwölf aus Irak nach Deutschland, allein. Und ist eine derer, die das "Poetry Project" zum Sprechen brachte. Praktisch: in Workshops, in geschützten Räumen mit Papier und Stift, Tee und Geduld. Im Symbolischen: indem das, was im Bewusstsein flackert oder in der Erinnerung wühlt, eine Gestalt finden kann und so an diffuser Macht verliert. Wie Menschen das eben praktizieren, seit sie ihre Ängste, ihre Träume und das Unbegreifliche auf Höhlenwände malen, in weichen Ton kratzen oder in Strophen singen. Nach der Umarmung die älteste Therapie der Welt; man kann auch Kunst dazu sagen.
Nun studiert Namer an der Humboldt-Universität; sie gehört zu den Geflüchteten, die seit einem Jahrzehnt zum Stadtbild gehören; in der Beschäftigungsquote, wie Koelbl in feiner Präzision bemerkt, "fünf Punkte unter der Gesamtbevölkerung". Namers Poetry-Project-Kollege Shazamir Hataki, inzwischen 25, ist heute Notfallmediziner an der Charité. Nicht nur hin und wieder, sondern immer wieder kommt es vor, dass seine Hilfe zurückgewiesen wird, weil seine Hände "die eines Kanaken sind": Dieser Abend ist keine Parade des reinen Gelingens und der Glückseligkeit.
Aber einer der auch sanften Überraschungen. Hanna Schygulla ist da, nicht nur als grande dame des Films, sondern auch als ehemaliges Flüchtlingskind. Keine drei Jahre zählte sie, als die Mutter sich mit ihr aus Oberschlesien nach München rettete; von der Flucht ist ihr nichts mehr in Erinnerung. Aber ein Satz, den sie später sagte, als sie einmal allein die Straße entlangspazierte und ein Passant sie fragte "Ja Butzerle, wo g'hörst du denn hin?" - "Zu mir."
Schygulla singt Lieder von Friedrich Hollaender, von Max Colpet und Franz Waxman, alle drei jüdische Flüchtlinge. Ihre Stimme oszilliert zwischen Verlorenheit und Lakonie, Sentiment und Pointe, die ambivalente Mischung vieler Chansons der Weimarer Republik. "Jetzt gehe ich allein, durch eine große Stadt / und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat". Der Flügel, auf dem Felix Raffel sie begleitet, steht im ehemals jüdischen Haus Liebermann, wo wir alle im zweiten Obergeschoss versammelt sind. 1943 wurde die Villa zerbombt, in den 1990er Jahren wieder aufgebaut. Nun ist sie ein Kulturzentrum und im Besitz der Familie Quandt, deren Vermögen im Nationalsozialismus erheblich gewachsen war. Sie ist wesentlicher Anteilseigner von BMW, in dessen Motorradwerk in Spandau Kahel Kashmeri heute arbeitet.
The Poetry Project, Ein Abend mit Hanna Schygulla; Liebermann Haus, 10.11.2025
Kommentieren