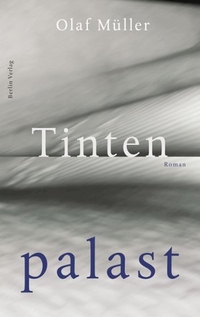Klappentext
"Als verringere sich die Entfernung zwischen der Namib und Deutschland mit jedem Schritt in die Wüste..." Henry Magdaleni hat Ostberlin direkt nach der Wende über Paris Richtung Afrika verlassen. Auf der Flucht vor seiner Vergangenheit zieht er verstört durch Namibia, nur sein geheimnisvolles Tagebuch "Tintenpalast" im Gepäck. Er ist in der Kleinstadt Blubars aufgewachsen, in der der Industrielle Rotuma - der Luftpumpengott - mit seinen beiden Töchtern auch nach der Enteignung herrscht. Obwohl er als Schwiegersohn nicht in Frage kommt, duldet der alte Rotuma den 17-jährigen Henry als Liebhaber seiner Töchter. Zwischen diesen beiden Frauen hin- und hergerissen und von der Gesellschaft abgelehnt, beginnt er mit der Niederschrift des "Tintenpalastes". Er ist ihm zugleich Notizbuch, Lebensakte und ein Ort, an dem er eine eigene Weltordnung entwerfen kann. In der Realität wird er zum Verräter einer Welt, deren Grundlagen er nicht anerkennen kann.
Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 06.03.2001
Der Titel "In den Sand gesetzt" kündigt unheilschwer an, was dann sogleich in dem totalen Verriss von Ute Stempel folgt. Nachdem die Rezensentin messerscharf den Roman seziert hat, bleibt am Ende nichts übrig weder vom Plot noch von der teilweise "gestelzten" Sprache. Von "Jagdszenen jungmännlicher Abrechnung" in Namibia weiß sie konsterniert zu berichten und vor allem von der wieder einmal vertanen Chance, ein Buch über die "deutsch-deutsche Zeithistorie" zu schreiben. Ihre Klage richtet sich aber nicht nur gegen den Autor, sondern auch gegen das Lektorat, das es unterlassen hat "einem unscharf philosophierenden Anfänger zu Hilfe" zu kommen. "Ein Roman also, dessen Teig mit allen Eiern angerührt ist. Ein Buch, das an seinem Stoff vorbeigeschrieben ist", mit diesen bitteren Worten endet die Rezension und der Autor kann einem fast ein wenig leid tun, von einer so brillanten Rezensentin besprochen worden zu sein.
Rezensionsnotiz zu Die Tageszeitung, 09.01.2001
Als es in der Wüste Namib endlich zum "Showdown" kommt, war nach Gerrit Bartels offenbar das Kind schon lange in den Brunnen gefallen. Für ihn bleibt im Roman zu viel zu lange unklar. Was verbindet die beiden Protagonisten Simon und Henry? Wieso verfolgt der eine den anderen? Hat nun einen den anderen in der DDR bespitzelt oder nicht? Das Rätselhafte in diesem Roman ist für Bartels keineswegs reizvoll, sondern anstrengend. Zwar findet er die Geschichte selbst durchaus "interessant". Doch verschwindet diese nach Bartels im Verlaufe des Buchs immer mehr hinter "knarzenden Metaphern und ächzenden Allegorien". Am Ende zeigt sich Bartels denn doch noch ein wenig versöhnlich. Als Henry seine Aufzeichnungen in eine Fluss wirft und damit einen Erlösungsversuch ganz eigener Art unternimmt, habe der Autor, wie der Rezensent erleichtert anmerkt, "dem Leben den Vorzug vor der Literatur gegeben".
Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 16.11.2000
Ein ordentlicher Verriss, ohne Wenn und Aber. Hubert Winkels findet den Roman herzzerreißend schlecht. Irgendwas zwischen "Jürgen Fuchs und heiligem Antonius", woran Sie merken, geneigte Leser, dass es um die DDR, die Stasi und existenzialistische Schuldverstrickungen geht. Der Rezensent schreibt sich in Hohn und Spott, auch wenn es um einen Romanerstling geht. Angelegt wie ein Rorschachtest, meint Winkels, ein Klecks, der als alles oder nichts gedeutet werden kann. Ein Roman, der alles will, große Geste, große Worte, schwere Geschichte; ein Roman, der nichts hergibt, ungenau, unpersönlich, eine einzige Pose, in den namibischen statt in den märkischen Sand gesetzt. Denn dorthin, nach Namibia, hat der Autor sein unklares Geschehen verlagert, um dort der postmodernen "écriture der Wüste" zu folgen und am Ende ein existenzialistisches Seelendrama à la Camus zu inszenieren. Da muss der Autor dringend etwas `für sein intelligenteres Selbst` tun - eine Phrase aus dem Müllerschen Textkonvolut, die Hubert Winkels mehrfach und mit Genuss gegen den Urheber wendet.
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 24.10.2000
Der Rezensent ist genervt. "Jede Minute mittlerer Straßenverkehr ist aufregender" schreibt er über Olaf Müllers Romandebüt "Tintenpalast". An anderer Stelle redet er von einer "elenden Sorte Deutsch", einem "Umstandsdeutsch", das Müllers der DDR entsprungene Protagonisten reden und dem Rezensenten überhaupt nicht einleuchten will. Und die Geschichte, die zwei Freunde aus der Ex-DDR nach Namibia verschlägt, im Übrigen auch nicht. Warum müssen sie in der Wüste herumballern? fragt Konrad Franke, aber das versteht der Leser der Rezension auch nicht mehr, da der Faden der Vermittlung an dieser Stelle eindeutig reißt. "Tintenpalast" heißt im Volksmund das Regierungsgebäude in Windhoek, ebenso tauft der Protagonist Henry sein Tagebuch, das er eines Tages mit einführt in die "Tintenpalast-Republik". Dort geht ein Showdown über die Bühne, das sich für Franke wie schlechtes Kino ausnimmt.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 18.10.2000
Zunehmend entnervt beschreibt Stephan Maus die Suche von Olaf Müllers Helden Henry nach der Sprache und nach sich selbst. Henry, der aus Nihilismus Stasi-Spitzel geworden ist und neben IM-Berichten ein nietzscheanisches Textbuch mit dem Titel `Tintenpalast` führt, flüchtet nach der Wende nach Windhoek, Namibia, wo ein Regierungspalast gleichen Titels steht. Selbst Henrys Utopie sei vom Stigma `tyrannischer Bürokratie` gezeichnet, schreibt Maus. In Namibia wird der Held von einem `Stasi-Jäger` mit ungewissem Auftrag halb verfolgt, halb begleitet. `Man weiß hier nichts Genaues` schreibt Maus über die kryptische Ich- und Sprachsuche in der namibischen Wüste, wo die beiden Männer mit Frauen und einer Kalaschnikow spielen. Der existenzielle Ton mache Müllers Prosa nicht lesbarer. Die Dialoge lesen sich wie `das Protokoll einer Gesprächstherapie`, schreibt Maus und scheint Gefallen an seinem Verriss zu finden: `Camel-Trophy mit Selbsterfahrungsgarantie`, `halluzinogene Schwitzhütte` und `therapeutische Schnitzeljagd` nennt er den Roman, der nur dort gelungen sei, wo er in eine Farce umkippe. Immerhin seien die Kulissen der Handlung überzeugend gezeichnet. Warum dieser Nachwenderoman allerdings in Namibia spielen muss, ist dem Rezensenten schleierhaft und nötigt ihn zu der Frage: `War Bruce Chatwin auch ein Berliner?`
Themengebiete
Kommentieren