Im Kino
Gute Mutter, böse Mutter
Die Filmkolumne. Von Elena Meilicke, Nikolaus Perneczky
17.04.2013. In Andrés Muschiettis Horrorfilm "Mama" sucht ein anorektischer Muttergeist das hedonistische Hipsterleben eines jungen Paares heim. Kein Land in Sicht ist derweil in Moussa Tourés Flüchtlingsdrama "Die Piroge".
Ohne Mutter kein Horror - feministische Filmtheoretikerinnen wissen das schon lange und haben eingehend untersucht, inwiefern das Horrorgenre immer wieder um Motive monströser Mutterschaft, weiblicher Sexualität und menschlicher Fortpflanzung kreist. Der Erstlingsfilm des Argentiniers Andrés Muschietti zieht dieses Genre-Paradigma konsequent durch und nennt sich ganz einfach - "Mama".
Am Anfang steht eine Familientragödie, ausgelöst durch die Finanzkrise im Jahr 2008 (der Film reaktualisiert damit einen weiteren interessanten Zusammenhang, den zwischen Horror und Wirtschaftskrise: seine erste große Blüte erlebte der amerikanische Horrorfilm in den 1930ern, zu Zeiten der Großen Depression). Ein junger Vater läuft Amok, tötet seine Geschäftspartner und die eigene Ehefrau. Die zwei kleinen Töchter Victoria und Lilly bringt er in eine einsame Hütte im Wald, doch bevor er auch sie erschießen kann, wird er selbst von einer nebelhaften Entität aus dem Weg geräumt.
Erst fünf Jahre später findet man die Mädchen wieder: Verwilderte Wolfskinder sind sie geworden, die sich rasend schnell auf allen Vieren bewegen und ihre Sprache verloren haben. Die Kinder kommen zu ihrem Onkel Lucas (Nikolaj Coster-Waldau), obwohl Zweifel an dessen Familientauglichkeit bestehen. Bislang hat Lucas mit seiner Freundin Annabelle (Jessica Chastain) ein hedonistisches Hipsterleben geführt, dessen absolute und gewollte Kinderlosigkeit der Film etwas übereindeutig zu etablieren versucht: ihren ersten Auftritt hat Annabelle auf dem Klo sitzend, einen negativen Schwangerschaftstest in der Hand, für den sie Gott euphorisch dankt: "Sweet!" Also nix Mama. Spätestens an dieser Stelle sind die weiteren Konfliktlinien des Films erahnbar: Annabelle - tough, burschikos, tätowiert - soll, muss, wird Mutter werden. Eine Bekehrung.

Insofern verfolgt "Mama" eine tendenziell reaktionäre Agenda, deren Umsetzung aber trotzdem ihre Reize hat. Denn Annabelles Weg zur (symbolischen, nicht-biologischen) Mutterschaft ist hart. Sie muss es aufnehmen mit einem mütterlichen Geist, der - so stellt sich heraus - die Kinder in der Waldisolation beschützt hat und weiterhin eifersüchtig Besitzansprüche auf sie stellt. Gute Mutter, böse Mutter, ganz klassisch. Auch klassisch unheimlich: Muschiettis Schreck- und Gruselverfahren sind nicht neu oder originell, aber effektiv. Ein bisschen "The Exorcist", ein bisschen Hitchcock, ein bisschen japanisches Horrorkino - so zitiert und rekombiniert "Mama" bekannte Motive und Versatzstücke und inszeniert das Ganze als kluges Spiel um Sichtbarkeiten und subjektive Einstellungen.
Betrachtet man "Mama" als generische Neuverhandlung des Mutter-Horror-Komplexes, dann fällt auf, dass schleimig-uterine Unheilshöhlen und monströse Geburtsvorgänge, wie sie etwa in den "Alien"-Filmen auftauchten, bei Muschietti keine Rolle spielen. Einzig das schwarz und zäh triefende Loch in der Wand, aus dem der Mama-Geist entströmt, erinnert entfernt an diese Ikonographie eines weiblich Abjekten. Ansonsten ist der Muttergeist ein eher unmütterlich anorektisches Wesen, für das die langgestreckten Schönheiten eines Modigliani Modell gestanden haben und das im Übrigen von einem hageren jungen Mann dargestellt wird: Javier Botet, der unter dem sogenannten Marfan-Syndrom leidet, das zu außergewöhnlichem Wachstum mit besonders langen und dünnen Gliedmaßen führt (hier mehr zur Produktion und Gestaltung des Muttergeistes).
Mama, ein Mann: letztlich verweist dieser Akt von Travestie vielleicht darauf, dass "Mama" wie auch immer geartete Mütterlichkeiten eben doch nicht nur dort platziert, wo man sie erwarten würden. Schön ist in diesem Zusammenhang auch, wie Produzent Guillermo del Toro die Rolle von Lucas/Nikolaj Coster-Waldau knapp auf den Punkt bringt: "Basically, he's playing the girlfriend. It's a very hard part to play. You need somebody that is able to be warm and casual and make the audience feel at home." Wenn das mal nicht "mütterlich" ist.
Elena Meilicke
---

Der Senegalese Moussa Touré ist seit gut dreißig Jahren als Regisseur tätig und hat mehr als ein Dutzend Filme realisiert. Auf IMDb sind lediglich vier davon angeführt. Nicht nur der notorische Mangel an finanziellen Mitteln, sprich: nicht nur ökonomische, sondern auch diskursive Ausschlussmechanismen wie Nichtbeachtung und Ignoranz, bringen jene typisch afrikanischen Filmografien hervor, die aus nur einer Handvoll von Titeln zu bestehen scheinen. Nichtbeachtung und Ignoranz: Unter dieser Überschrift könnte man auch das Verhältnis des regulären deutschen Kinobetriebs zum afrikanischen Filmschaffen der Gegenwart beschreiben. Umso erfreulicher, dass Tourés neuer Spielfilm, das Flüchtlingsdrama "Die Piroge", den Weg zu einem deutschen Verleih gefunden hat (was vermutlich auch damit zu tun hat, dass der Evangelische Entwicklungsdienst im Vorspann neben den üblichen Verdächtigen aus Frankreich - Arte, Canal+ und Centre national du cinéma - als Förderinstanz auftritt).
"La pirogue" setzt ein mit einer Ringkampfszene: Ein muskulöser junger Mann wird rituell anmutenden Waschungen unterzogen, von den umliegenden Sitzrängen schallt der Singsang hunderter Schlachtenbummler. Der Kampf selbst wird nur einen flüchtigen Augenblick dauern, schon sind wir beim Heimweg, auf dem zwei junge Fischer, Baye Laye und Kaba, sich über das beim Ringkampf ausschlaggebende Talent streiten: Kraft oder Wendigkeit? Als der Kampf noch in Gange war, hatte sich auf den Zuschauerrängen noch etwas anderes zugetragen, das man erst später verstehen wird: in die Tiefe gestaffelte und durch Schärfenverlagerungen vermittelte Nahaufnahmen einiger Männer, einander intensive Blicke zuwerfend. In dem konspirativen Blickwechsel deutet sich das gefährliche Vorhaben an, von dessen Durchführung "Die Piroge" handeln wird.

Bevor es so weit ist, nimmt sich der Film noch etwas Zeit, den Ausgangsort seiner Bewegung auszumalen: Eine Ortschaft irgendwo an der senegalesischen Küste, junge Fischer vor ausgefischten Gewässern, thesenhafte Alltagsvignetten. Wenn Abou, der von einer Musikerkarriere in Paris träumt, die Frau seines Bruders Baye Laye auf Französisch grüßt, hallt es trotzig zurück: "Aleikum salam!" Und als Baye Laye ihr den Plan offenbart, in einer Piroge (eigentlich: Einbaum) nach Spanien überzusetzen, erwidert sie nur: "Geh lieber nach China, Europa steckt in der Krise." Leider findet der Film kein Verhältnis zu seinen Figuren, das die mechanische Didaktik solcher Passagen überschreiten oder doch wenigstens verkomplizieren könnte. Die seltsam unbehauste Welt, wenig mehr als ein Gerüst zur Anbringung der ebenso groben Figurensoziologie, bleibt auch filmästhetisch unterbestimmt. Professionell kadriert und farbkorrigiert, machen die HD-Bilder einen manchmal sterilen Eindruck. Touré weiß Bescheid und will, dass wir es ihm gleichtun: Erklärung triumphiert über Entdeckung.
Erst auf dem Boot kommt "Die Piroge" zu sich - und auch dort nur momentweise, in jenen herausstechenden Szenen, die sich entweder den Naturgewalten oder im Gegenteil der filmischen Form ausliefern. Kurz vor dem Ende, wenn die Überlebenden der strapaziösen Fahrt jeder für sich ein eigenes Voice-over bekommen, worin die individuellen Geschichten ins Parabolische kippen, beweist Touré, dass er mehr ist als ein professioneller Abwickler tagespolitisch relevanter Themenfilme. Der didaktische Impuls liegt an der Oberfläche, wird von der Positivität des Bescheidwissens umgebogen zur kritischen Transparenz der filmischen Mittel.
Auch wenn diesen klapprigen Kahn äußerlich wenig mit dem auf Grund gelaufenen Kreuzfahrtschiff Costa Concordia verbindet, auf dem Godard seinen "Film Socialisme" drehte: Der Heterotopos der Seefahrt ist allerorten leck. In den besten Momenten von "Die Piroge" gelingt es Touré, ihn doch noch einmal zu beschwören, als sich entziehendes Versprechen von einem besseren Leben auf der anderen Seite des Ufers; ein Versprechen, an dem das diesseitige Elend sich umso deutlicher konturiert. Wenn die Kamera einmal nicht ganz nah bei den Gesichtern der Flüchtlinge verweilt, schweift der Blick gen Horizont. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, weder für den Film, noch für seine Figuren. Kein Land in Sicht.
Nikolaus Perneczky
Mama - Spanien, Kanada 2013 - Regie: Andrés Muschietti - Darsteller: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier, Isabelle Nelisse, Daniel Kash, Javier Botet - Laufzeit: 100 min.
Die Piroge - Senegal, Frankreich, Deutschland 2012 - Regie: Moussa Touré - Darsteller: Souleymane Seye Ndiaye, Laïty Fall, Malaminé 'Yalenguen' Dramé, Balla Diarra, Salif 'Jean' Diallo, Babacar Oualy - Laufzeit: 87 min.
Kommentieren








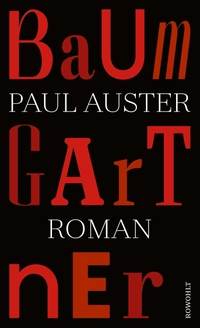 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung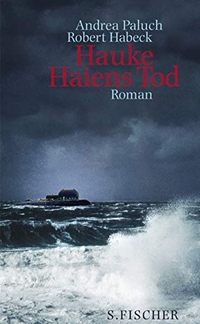 Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod
Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod