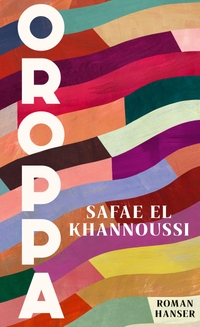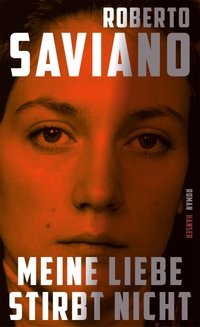Essay
Let's Talk European!
Von Thierry Chervel
01.03.2005. Heute um elf Uhr geht signandsight.com online. Zum Start ein Manifest: Let's Talk European! "Un ange passe", sagen die Franzosen, wenn ein Stimmengewirr plötzlich verstummt. Der Engel heißt Europa. Neulich ist er über das Grab von Pierre Bourdieu spaziert.
Es ist nur eine kleine Geschichte, ein bisschen traurig und ein bisschen lächerlich, eigentlich nebensächlich, aber sie sagt etwas über europäische Öffentlichkeit aus. Kurz vor seinem Tod wandte sich der große Soziologe noch einmal einem ihm lieben, zugleich aber verdächtigen Gegenstand zu: sich selbst. Ein Bauernjunge aus dem Bearn, der die kulturellen Klippen der Ecole Normale Superieure überwunden und es am Ende zum Herrgott der Soziologie gebracht hatte. Diese verdammte eigene Erfolgsgeschichte stand in eklatanetem Widerspruch zur Soziolgie Bourdieus, die alles aus Herkunft und Habitus erklären wollte. Bourdieu schrieb sein letztes Buch mit dem Titel "Ein soziologischer Selbstversuch" und ist kurz darauf gestorben.
Wenig später brachte der Nouvel Observateur einen Auszug aus dem Text und erzeugte damit eine Sensation. Bourdieu war der letzte Intellektuelle, der in den Pariser Medien noch ein solch fiebriges Getümmel auslösen konnte. Er hasste sie dafür. Selbstverständlich war der Vorabdruck im Nouvel Obs von Bourdieus Erben nicht autorisiert. Denn Bourdieu hatte den französischen Journalisten ein Schnippchen geschlagen - der Text sollte zunächst auf Deutsch in Deutschland erscheinen, dann erst in Frankreich. Bourdieu wollte keinen hektischen Medienhype für seine heikle Selbstreflexion, er erhoffte sich eine ruhige und ernste Debatte. Aber wollte er, was dann geschah?
Es geschah... nichts. Einige Monate nach Bourdieus Tod erschien "Ein soziologischer Selbstversuch" als schmales Bändchen der Edition Suhrkamp. Stille. Die deutschen Medien begriffen gar nicht, dass hier eine Geschichte vorlag, ein anderweitig heiß ersehnter Text, ein Geschenk Bourdieus an die als qualifizierter gedachte deutsche Öffentlichkeit. Monate später brachten die Zeitungen einige Pflichtrezensionen. Auch in Frankreich löste der Band nicht die leiseste Reaktion aus. Was vor Monaten im Auszug noch Skandal erregte, lag nun vor und schien doch nicht zu existieren. Niemand liest in französischen Medien ernstlich deutsch, und sie beschäftigen auch keine Scouts, die die kulturellen Schwingungen in Deutschland registrieren. Erst als der Band in Frankreich erschien, erzeugte er das übliche Tohuwabohu.
Gibt es ein Europa jenseits der Milchquoten?
Offensichtlich nur als Engel, der durch den Raum geht, als Gesprächspause und Leerstelle in der Kommunikation. Der Bourdieu-Effekt trat zuletzt ja häufiger ein. Jürgen Habermas lancierte eine Kerneuropa-Intitiative, aber niemand diskutierte mit. Wer kannte außerhalb der Niederlande Theo van Gogh, bevor er ermordet wurde? Und als in Paris im August letzten Jahres des sechzigsten Jahrestags der Befreiung der Stadt gedacht wurde, sprach niemand darüber, was gleichzeitig in Warschau geschah. Während in Paris einige Straßen nach kommunistischen Resistants benannt wurden, deren Heldenmut nach 1941 ja unbestritten ist, erinnerte man sich in Warschau an das eisige Lächeln, mit dem Stalin zusah, als Hitler den polnischen Widerstand in Grund und Boden bombardierte. Ende der Befreiung.
Am größten ist die Ignoranz in den großen Ländern Westeuropas, deren Öffentlichkeiten noch selbstgenügsam in sich ruhen. Man befasst sich mit den nationalen K-Fragen, Late-Night-Comedystars und Fußballskandalen. Die Intellektuellen sitzen wie im Kino: Sie blicken parallel und gebannt, den Nachbarn gar nicht wahrnehmend, in eine einzige Richtung und schnaufen empört über die neuesten Untaten des bösen Buben George W. Bush. Den Phantomschmerz des Utopieverlusts nach dem Fall der Mauer betäubt man mit Globalisierungskritik. Aber gerade die Globalisierungsgegner produzieren jene krankhafte Amerikafixierung, die sie vorgeben zu kritisieren. Sie wollen, dass das Böse einen festen Ort hat und meiden darum den Blick in andere Richtungen, zum Beispiel auch mal nach Tschetschenien. Oder zum Nachbarn. Ist es wirklich die Schuld von Bill Gates und Steven Spielberg, dass die Franzosen immer seltener Deutsch und die Deutschen immer seltener Französisch lernen?
In der französischen Ausgabe von "Le Monde diplomatique", dem Zentralorgan der Globalisierungsgegner, erschien jüngst ein Text von Bernard Cassen über eine wünschenswerte internationale Sprachenpolitik. Cassen will dort den Einfluss des Englischen eindämmen, das er als Vektor des Neoliberalismus wahrnimmt: "Die imperiale Macht der USA beruht nicht nur auf materiellen Faktoren (wie militärische Macht und wissenschaftliches Know-how, Produktion von Waren und Dienstleistungen, Kontrolle der Geld- und Energieströme etc.): Sie verkörpert auch und vor allem die Herrschaft über den Geist, also über die kulturellen Zeichen und den kulturellen Bezugsrahmen - und dabei ganz besonders über die sprachlichen Zeichen."
Englisch ist der Dollar des Diskurses! Darum schlägt Cassen eine Sprachgruppenpolitik vor. In den Schulen romanischer Länder sollen die Sprachen der anderen "Romanophonen" zumindest so weit gelehrt werden, dass ein Franzose fähig wäre, einen Spanier oder Brasilianer zu verstehen und umgekehrt. Die Deutschen könnten demnach blendend mit den Dänen und Niederländern plaudern. Die Polen wären gezwungen, mit den Russen Konversation zu treiben.
Europa kommt in Cassens Vision allenfalls als ein Brüsseler Institution vor, die droht, unter dem Einfluss des Englischen einzuknicken. Die europäische Öffentlichkeit zerfällt ihm in seinem Antidiskurs wie Staub in den Händen, sie interessiert ihn gar nicht. Sein Traum sind vor allem die romanischen Sprachen, die er als "eine einzige Sprache" betrachten möchte, um ein wuchtiges Gegengewicht zur verhassten Sprache des Kapitalismus zu schaffen. Der Fixierung auf Amerika erliegen gerade seine Feinde.
Durch das Internet wurde der Einfluss des Englischen allerdings in der Tat vergrößert. Zwar ermöglicht das Netz eine extreme Spezialisierung der Öffentlichkeiten - hier findet sogar der Kannibale willige Nahrung -, zugleich aber eröffnet das Netz alle seine Möglichkeiten nur, wenn gewisse Standards der Kommunikation eingehalten werden. Zu diesen Standards gehören Programmiersprachen wie Html oder Linux oder auch Komprimierungsverfahren wie MP3, aber dummerweise weithin auch die englische Sprache. Seltsamerweise wurden Standards wie MP3 oder das World Wide Web in Europa erfunden, nicht aber Amazon, Google, Ebay und Yahoo. Diese Dienste habe das Leben jedes Einzelnen, der lesen und schreiben und einen Computer bedienen kann, verändert. Sie berühren auch die Öffentlichkeiten und strukturieren sie neu. Es ist ein Rätsel, warum keine dieser ebenso großartigen wie problematischen Ideen in Europa entstanden ist.
Auch die englischsprachigen Medien selbst haben durch das Internet ein höheres Gewicht erhalten. Die "New York Times" pflegt einen der besten Internetauftritte internationaler Qualitätszeitungen. Durch ihre Newsletters dürfte sie inzwischen ein breiteres Publikum erreichen als durch den Extrakt, der als "International Herald Tribune" in Europa zirkuliert. Wer im Netz nach dem 11. September Informationen über Afghanistan oder den islamischen Terrorismus suchte, war besser dran, wenn er englisch sprach. Auf deutsch oder französisch war jedenfalls kaum etwas zu finden. Und wie wird's wohl mit dem Arabischen gestanden haben? Es waren keineswegs nur amerikanische Medien, die diese Informationen lieferten, sondern ebenso sehr spezialisierte Universitätsinstitute, die Internetadressen von Think Tanks oder afghanischer Exilvereine. Cassen hat unrecht, wenn er behauptet, das Englische transportiere nur eine Ideologie oder gar die die exklusiven Interessen eines einzigen Landes. Die - durchaus amerikakritische! - englischsprachige Zeitschrift "Outlook India" rangiert bei Googel genau so hoch wie der "Weekly Standard" der Necons. Selbst Al Dschasira wird demnächst auf Englisch senden, um ein weltweites Publikum zu gewinnen.
Dennoch droht eine doppelte Provinzialisierung. Denn einerseits besteht wie gesagt eine Tendenz größerer nicht englischsprachiger Öffentlichkeiten - also etwa Frankreichs und Deutschlands - zur Selbstgenügsamkeit. Hinzu kommt, dass Zeitungen wie die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine ihre Inhalte vom allgemein zugänglichen Internet abschotten und allein zahlenden Abonnenten vorbehalten. Europäische Journalisten nutzen zwar alle Quellen in englischer Sprache, die sie im Internet finden, aber ihre eigenen Zeitungen schotten ihre Inhalte ab und machen kein Angebot zur Kommunikation in die Gegenrichtung. Europäische Zeitungen waren überdies nie interessiert oder in der Lage, europäische Netzwerke zu bilden. Die einzige Zeitung die eine europäische Öffentlichkeit herstellen könnte, wenn ihr Eigner es wollte, wäre die International Herald Tribune. Und ihr Eigner sitzt in New York!
Und andererseits erinnere man sich an die Liebe des amerikanischen Kinos zu Paris bis in die fünfziger Jahre. Die Blickrichtung war einmal umgekehrt. Europa hatte etwas zu sagen, und Amerika schien es hören zu wollen. Heute droht auch eine Provinzialisierung der englischsprachigen Öffentlichkeiten, wenn Europa nur eine Leerstelle in der Kommunikation bleibt.
Es ist an der Zeit sich aus der Blickstarre zu lösen, den Nacken zu massieren und auf die eigenen Stärken zu besinnen. Deutschland zum Beispiel hat doch die besten Feuilletons der Welt! Sie reflektieren nicht nur eine einzigartige Kulturlandschaft mit erstklassigen Opernhäusern und Museen in jeder mittleren Stadt, sie sind auch ein einzigartiger Debattenraum. Hier finden nicht nur kulturelle, sondern auch politische und gesellschaftliche Debatten statt. Demographen schreiben über schrumpfende Städte, Ärzte über Bioethik, Jeremy Rifkin über Europa und Gilles Kepel oder Bernard Lewis über den Islam.
Auch wenn die Feuilletonredakteure manchmal dem Missverständnis erliegen, ihre eigenen, oftmals so brillanten Artikel für das eigentlich Wichtige zu halten, auch wenn Recherche oder das Erzählen von Geschichten in deutschen Feuilletons eher als inopportun gelten: Die Feuilletons sind doch der einzige wirklich gesellschaftliche und kosmopolitische Debattenraum der deutschen Öffentlichkeit. Von hier ging der Historikerstreit aus, der das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Geschichte neu definierte. Hier schreiben Günter Grass über das Copyright oder Andrzej Stasiuk über die Ukraine. Gerade die relative Offenheit zu Osteuropa ist eine ungeheure Stärke. Hier ist Deutschland deutlich weniger provinziell als Westeuropa und die englischsprachigen Länder. Hätte Imre Kertesz den Nobelpreis gewonnen, wenn er nicht in Deutschland solche Erfolge gefeiert hätte? Die Deutschen lesen gerne international: Sie wissen, dass Peter Esterhazy oder Juri Andruchowytsch großartige Autoren sind.
Die erstaunliche Debattenkultur der deutschen Feuilletons erklärt sich aus der Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg vergaben die Alliierten die Lizenzen für die Zeitungen an einigermaßen unbescholtene Deutsche. "Lehrt die Deutschen die Demokratie", gaben sie ihnen mit auf den Weg, "aber lasst sie um Gottes willen nicht zu Wort kommen, denn der Schoß ist fruchtbar noch." Daran haben sich die politischen Redakteure bis heute gern gehalten und die politischen Kommentarseiten vor der Öffentlichkeit versperrt. Hier dürfen sich nur verbriefte, fest angestellte Redakteure äußern. So ergab sich auf den politischen Seiten der Zeitungen ein steriles Präzeptorentum der immer gleichen Meinungshaber, während die eigentliche Wirrnis der Welt, die Trübsal und Buntheit der Diskurse ins Feuilleton auswich.
Jenseits der Grenzen ist darüber wenig bekannt, weil das Deutsche allgemein als eine Art Altgriechisch der Gegenwart gilt und wenig praktiziert wird. Wäre es nicht an der Zeit, einiges davon ins Englische zu übersetzen? Für Europa, und natürlich für China, Russland, Indien, Burkina Faso und die USA.
Die Öffentlichkeit internationalisiert sich. "Le Monde diplomatique" macht es mit seinen vielen Ablegern ja durchaus vor. Ein weiteres sehr vornehmes Beispiel ist das Netzwerk der "Lettre International", die in vielen europäischen Städten erscheint und auch mit dem Lettre Ulysses Award für literarische Reportage an der gegenseitigen Wahrnehmung der Kulturen arbeitet. Eurozine präsentiert im Internet englische, deutsche und französische Übersetzungen von europäischen Kulturzeitschriften aus allen Ländern. signandsight.com wird Artikel aus deutschsprachigen Feuilletons auf Englisch präsentieren: Regionale Differenz braucht das Idiom der Globalisierung um sich zu artikulieren.
Un ange passe: Let's talk European!
Es ist nur eine kleine Geschichte, ein bisschen traurig und ein bisschen lächerlich, eigentlich nebensächlich, aber sie sagt etwas über europäische Öffentlichkeit aus. Kurz vor seinem Tod wandte sich der große Soziologe noch einmal einem ihm lieben, zugleich aber verdächtigen Gegenstand zu: sich selbst. Ein Bauernjunge aus dem Bearn, der die kulturellen Klippen der Ecole Normale Superieure überwunden und es am Ende zum Herrgott der Soziologie gebracht hatte. Diese verdammte eigene Erfolgsgeschichte stand in eklatanetem Widerspruch zur Soziolgie Bourdieus, die alles aus Herkunft und Habitus erklären wollte. Bourdieu schrieb sein letztes Buch mit dem Titel "Ein soziologischer Selbstversuch" und ist kurz darauf gestorben.
Wenig später brachte der Nouvel Observateur einen Auszug aus dem Text und erzeugte damit eine Sensation. Bourdieu war der letzte Intellektuelle, der in den Pariser Medien noch ein solch fiebriges Getümmel auslösen konnte. Er hasste sie dafür. Selbstverständlich war der Vorabdruck im Nouvel Obs von Bourdieus Erben nicht autorisiert. Denn Bourdieu hatte den französischen Journalisten ein Schnippchen geschlagen - der Text sollte zunächst auf Deutsch in Deutschland erscheinen, dann erst in Frankreich. Bourdieu wollte keinen hektischen Medienhype für seine heikle Selbstreflexion, er erhoffte sich eine ruhige und ernste Debatte. Aber wollte er, was dann geschah?
Es geschah... nichts. Einige Monate nach Bourdieus Tod erschien "Ein soziologischer Selbstversuch" als schmales Bändchen der Edition Suhrkamp. Stille. Die deutschen Medien begriffen gar nicht, dass hier eine Geschichte vorlag, ein anderweitig heiß ersehnter Text, ein Geschenk Bourdieus an die als qualifizierter gedachte deutsche Öffentlichkeit. Monate später brachten die Zeitungen einige Pflichtrezensionen. Auch in Frankreich löste der Band nicht die leiseste Reaktion aus. Was vor Monaten im Auszug noch Skandal erregte, lag nun vor und schien doch nicht zu existieren. Niemand liest in französischen Medien ernstlich deutsch, und sie beschäftigen auch keine Scouts, die die kulturellen Schwingungen in Deutschland registrieren. Erst als der Band in Frankreich erschien, erzeugte er das übliche Tohuwabohu.
Gibt es ein Europa jenseits der Milchquoten?
Offensichtlich nur als Engel, der durch den Raum geht, als Gesprächspause und Leerstelle in der Kommunikation. Der Bourdieu-Effekt trat zuletzt ja häufiger ein. Jürgen Habermas lancierte eine Kerneuropa-Intitiative, aber niemand diskutierte mit. Wer kannte außerhalb der Niederlande Theo van Gogh, bevor er ermordet wurde? Und als in Paris im August letzten Jahres des sechzigsten Jahrestags der Befreiung der Stadt gedacht wurde, sprach niemand darüber, was gleichzeitig in Warschau geschah. Während in Paris einige Straßen nach kommunistischen Resistants benannt wurden, deren Heldenmut nach 1941 ja unbestritten ist, erinnerte man sich in Warschau an das eisige Lächeln, mit dem Stalin zusah, als Hitler den polnischen Widerstand in Grund und Boden bombardierte. Ende der Befreiung.
Am größten ist die Ignoranz in den großen Ländern Westeuropas, deren Öffentlichkeiten noch selbstgenügsam in sich ruhen. Man befasst sich mit den nationalen K-Fragen, Late-Night-Comedystars und Fußballskandalen. Die Intellektuellen sitzen wie im Kino: Sie blicken parallel und gebannt, den Nachbarn gar nicht wahrnehmend, in eine einzige Richtung und schnaufen empört über die neuesten Untaten des bösen Buben George W. Bush. Den Phantomschmerz des Utopieverlusts nach dem Fall der Mauer betäubt man mit Globalisierungskritik. Aber gerade die Globalisierungsgegner produzieren jene krankhafte Amerikafixierung, die sie vorgeben zu kritisieren. Sie wollen, dass das Böse einen festen Ort hat und meiden darum den Blick in andere Richtungen, zum Beispiel auch mal nach Tschetschenien. Oder zum Nachbarn. Ist es wirklich die Schuld von Bill Gates und Steven Spielberg, dass die Franzosen immer seltener Deutsch und die Deutschen immer seltener Französisch lernen?
In der französischen Ausgabe von "Le Monde diplomatique", dem Zentralorgan der Globalisierungsgegner, erschien jüngst ein Text von Bernard Cassen über eine wünschenswerte internationale Sprachenpolitik. Cassen will dort den Einfluss des Englischen eindämmen, das er als Vektor des Neoliberalismus wahrnimmt: "Die imperiale Macht der USA beruht nicht nur auf materiellen Faktoren (wie militärische Macht und wissenschaftliches Know-how, Produktion von Waren und Dienstleistungen, Kontrolle der Geld- und Energieströme etc.): Sie verkörpert auch und vor allem die Herrschaft über den Geist, also über die kulturellen Zeichen und den kulturellen Bezugsrahmen - und dabei ganz besonders über die sprachlichen Zeichen."
Englisch ist der Dollar des Diskurses! Darum schlägt Cassen eine Sprachgruppenpolitik vor. In den Schulen romanischer Länder sollen die Sprachen der anderen "Romanophonen" zumindest so weit gelehrt werden, dass ein Franzose fähig wäre, einen Spanier oder Brasilianer zu verstehen und umgekehrt. Die Deutschen könnten demnach blendend mit den Dänen und Niederländern plaudern. Die Polen wären gezwungen, mit den Russen Konversation zu treiben.
Europa kommt in Cassens Vision allenfalls als ein Brüsseler Institution vor, die droht, unter dem Einfluss des Englischen einzuknicken. Die europäische Öffentlichkeit zerfällt ihm in seinem Antidiskurs wie Staub in den Händen, sie interessiert ihn gar nicht. Sein Traum sind vor allem die romanischen Sprachen, die er als "eine einzige Sprache" betrachten möchte, um ein wuchtiges Gegengewicht zur verhassten Sprache des Kapitalismus zu schaffen. Der Fixierung auf Amerika erliegen gerade seine Feinde.
Durch das Internet wurde der Einfluss des Englischen allerdings in der Tat vergrößert. Zwar ermöglicht das Netz eine extreme Spezialisierung der Öffentlichkeiten - hier findet sogar der Kannibale willige Nahrung -, zugleich aber eröffnet das Netz alle seine Möglichkeiten nur, wenn gewisse Standards der Kommunikation eingehalten werden. Zu diesen Standards gehören Programmiersprachen wie Html oder Linux oder auch Komprimierungsverfahren wie MP3, aber dummerweise weithin auch die englische Sprache. Seltsamerweise wurden Standards wie MP3 oder das World Wide Web in Europa erfunden, nicht aber Amazon, Google, Ebay und Yahoo. Diese Dienste habe das Leben jedes Einzelnen, der lesen und schreiben und einen Computer bedienen kann, verändert. Sie berühren auch die Öffentlichkeiten und strukturieren sie neu. Es ist ein Rätsel, warum keine dieser ebenso großartigen wie problematischen Ideen in Europa entstanden ist.
Auch die englischsprachigen Medien selbst haben durch das Internet ein höheres Gewicht erhalten. Die "New York Times" pflegt einen der besten Internetauftritte internationaler Qualitätszeitungen. Durch ihre Newsletters dürfte sie inzwischen ein breiteres Publikum erreichen als durch den Extrakt, der als "International Herald Tribune" in Europa zirkuliert. Wer im Netz nach dem 11. September Informationen über Afghanistan oder den islamischen Terrorismus suchte, war besser dran, wenn er englisch sprach. Auf deutsch oder französisch war jedenfalls kaum etwas zu finden. Und wie wird's wohl mit dem Arabischen gestanden haben? Es waren keineswegs nur amerikanische Medien, die diese Informationen lieferten, sondern ebenso sehr spezialisierte Universitätsinstitute, die Internetadressen von Think Tanks oder afghanischer Exilvereine. Cassen hat unrecht, wenn er behauptet, das Englische transportiere nur eine Ideologie oder gar die die exklusiven Interessen eines einzigen Landes. Die - durchaus amerikakritische! - englischsprachige Zeitschrift "Outlook India" rangiert bei Googel genau so hoch wie der "Weekly Standard" der Necons. Selbst Al Dschasira wird demnächst auf Englisch senden, um ein weltweites Publikum zu gewinnen.
Dennoch droht eine doppelte Provinzialisierung. Denn einerseits besteht wie gesagt eine Tendenz größerer nicht englischsprachiger Öffentlichkeiten - also etwa Frankreichs und Deutschlands - zur Selbstgenügsamkeit. Hinzu kommt, dass Zeitungen wie die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine ihre Inhalte vom allgemein zugänglichen Internet abschotten und allein zahlenden Abonnenten vorbehalten. Europäische Journalisten nutzen zwar alle Quellen in englischer Sprache, die sie im Internet finden, aber ihre eigenen Zeitungen schotten ihre Inhalte ab und machen kein Angebot zur Kommunikation in die Gegenrichtung. Europäische Zeitungen waren überdies nie interessiert oder in der Lage, europäische Netzwerke zu bilden. Die einzige Zeitung die eine europäische Öffentlichkeit herstellen könnte, wenn ihr Eigner es wollte, wäre die International Herald Tribune. Und ihr Eigner sitzt in New York!
Und andererseits erinnere man sich an die Liebe des amerikanischen Kinos zu Paris bis in die fünfziger Jahre. Die Blickrichtung war einmal umgekehrt. Europa hatte etwas zu sagen, und Amerika schien es hören zu wollen. Heute droht auch eine Provinzialisierung der englischsprachigen Öffentlichkeiten, wenn Europa nur eine Leerstelle in der Kommunikation bleibt.
Es ist an der Zeit sich aus der Blickstarre zu lösen, den Nacken zu massieren und auf die eigenen Stärken zu besinnen. Deutschland zum Beispiel hat doch die besten Feuilletons der Welt! Sie reflektieren nicht nur eine einzigartige Kulturlandschaft mit erstklassigen Opernhäusern und Museen in jeder mittleren Stadt, sie sind auch ein einzigartiger Debattenraum. Hier finden nicht nur kulturelle, sondern auch politische und gesellschaftliche Debatten statt. Demographen schreiben über schrumpfende Städte, Ärzte über Bioethik, Jeremy Rifkin über Europa und Gilles Kepel oder Bernard Lewis über den Islam.
Auch wenn die Feuilletonredakteure manchmal dem Missverständnis erliegen, ihre eigenen, oftmals so brillanten Artikel für das eigentlich Wichtige zu halten, auch wenn Recherche oder das Erzählen von Geschichten in deutschen Feuilletons eher als inopportun gelten: Die Feuilletons sind doch der einzige wirklich gesellschaftliche und kosmopolitische Debattenraum der deutschen Öffentlichkeit. Von hier ging der Historikerstreit aus, der das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Geschichte neu definierte. Hier schreiben Günter Grass über das Copyright oder Andrzej Stasiuk über die Ukraine. Gerade die relative Offenheit zu Osteuropa ist eine ungeheure Stärke. Hier ist Deutschland deutlich weniger provinziell als Westeuropa und die englischsprachigen Länder. Hätte Imre Kertesz den Nobelpreis gewonnen, wenn er nicht in Deutschland solche Erfolge gefeiert hätte? Die Deutschen lesen gerne international: Sie wissen, dass Peter Esterhazy oder Juri Andruchowytsch großartige Autoren sind.
Die erstaunliche Debattenkultur der deutschen Feuilletons erklärt sich aus der Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg vergaben die Alliierten die Lizenzen für die Zeitungen an einigermaßen unbescholtene Deutsche. "Lehrt die Deutschen die Demokratie", gaben sie ihnen mit auf den Weg, "aber lasst sie um Gottes willen nicht zu Wort kommen, denn der Schoß ist fruchtbar noch." Daran haben sich die politischen Redakteure bis heute gern gehalten und die politischen Kommentarseiten vor der Öffentlichkeit versperrt. Hier dürfen sich nur verbriefte, fest angestellte Redakteure äußern. So ergab sich auf den politischen Seiten der Zeitungen ein steriles Präzeptorentum der immer gleichen Meinungshaber, während die eigentliche Wirrnis der Welt, die Trübsal und Buntheit der Diskurse ins Feuilleton auswich.
Jenseits der Grenzen ist darüber wenig bekannt, weil das Deutsche allgemein als eine Art Altgriechisch der Gegenwart gilt und wenig praktiziert wird. Wäre es nicht an der Zeit, einiges davon ins Englische zu übersetzen? Für Europa, und natürlich für China, Russland, Indien, Burkina Faso und die USA.
Die Öffentlichkeit internationalisiert sich. "Le Monde diplomatique" macht es mit seinen vielen Ablegern ja durchaus vor. Ein weiteres sehr vornehmes Beispiel ist das Netzwerk der "Lettre International", die in vielen europäischen Städten erscheint und auch mit dem Lettre Ulysses Award für literarische Reportage an der gegenseitigen Wahrnehmung der Kulturen arbeitet. Eurozine präsentiert im Internet englische, deutsche und französische Übersetzungen von europäischen Kulturzeitschriften aus allen Ländern. signandsight.com wird Artikel aus deutschsprachigen Feuilletons auf Englisch präsentieren: Regionale Differenz braucht das Idiom der Globalisierung um sich zu artikulieren.
Un ange passe: Let's talk European!
Kommentieren