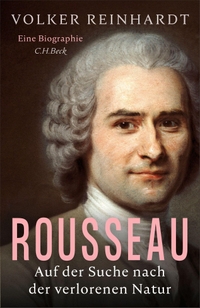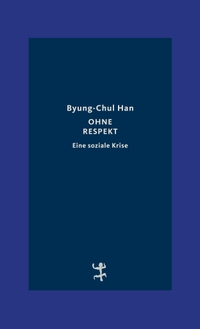Essay
Eine Utopie stirbt
Von Caroline Fourest
08.06.2010. Die Idee der allgemeinen Menschenrechte, die vor sechzig Jahren nicht nur von westlichen Nationen in der UNO festgeschrieben wurde, zerfällt. Statt ihrer werden Gruppenrechte im Namen von Religion und Kultur eingefordert. Es handelt sich bei dem nachfolgenden Text um das Vorwort aus Caroline Fourests letztem Buch "La derniere utopie" (Grasset, Paris, 287 Seiten, 20 Euro), in dem die Autorin den Zerfall der Idee allgemeiner Menschenrechte im Zeichen der Religion (besonders des Islams) und des Multikulturalismus analysiert. Fourest macht in diesem Buch kein Hehl daraus, dass ihr am abstrakten Begriff der Menschenrechte aus der französischen Tradition liegt. Mehr zu dem Buch im Blog der Autorin. Wir danken ihr für die Nachdruckgenehmigung. (D.Red.)
Es handelt sich bei dem nachfolgenden Text um das Vorwort aus Caroline Fourests letztem Buch "La derniere utopie" (Grasset, Paris, 287 Seiten, 20 Euro), in dem die Autorin den Zerfall der Idee allgemeiner Menschenrechte im Zeichen der Religion (besonders des Islams) und des Multikulturalismus analysiert. Fourest macht in diesem Buch kein Hehl daraus, dass ihr am abstrakten Begriff der Menschenrechte aus der französischen Tradition liegt. Mehr zu dem Buch im Blog der Autorin. Wir danken ihr für die Nachdruckgenehmigung. (D.Red.)= = = = = = = = = = = =
Eine Utopie stirbt - die Utopie der Menschenrechte, die Perspektive einer Welt, in der alle menschlichen Wesen frei und gleich wären, ohne Unterschied. Ein Traum, der vom ersten Atemzug an in jedem Menschen lebt, dessen Spuren in allen Zivilisationen und Kulturen zu finden sind. Vor sechzig Jahren wurde dieses Ziel in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der UN formuliert. Fast ein Wunder. Vielleicht eine Illusion. Denn so ausgelaugt scheint uns die Ambition jener Epoche heute, so umstellt von Feindschaft.
Dank der neuen Technologien und der sozialen Netze schafft sich der Mensch immer weitere Horizonte und immer mehr Kontakte. So gesehen lässt sich die Globalisierung als ein Sprung in Richtung mehr Universalismus sehen - vor allem dann, wenn die Vernetzung dazu dient, die Propaganda von Diktaturen auszuspielen und auf der Basis eines gemeinsamen Ideals Solidarität zwischen Demokraten der ganzen Welt zu schaffen. Allerdings muss man mit dieser Unendlichkeit umgehen lernen. Die Globalisierung der Information bedeutet auch eine Globalisierung von Ängsten und Leidenschaften. Einige Ereignisse wie der 11. September oder der Nahostkonflikt lösen starke Reizreaktionen aus. Je schneller man in dieser Welt reagieren muss, desto unreflektierter, irrationaler sind die Reaktionen.
In der Flut der Nachrichten und Kommunikationsangebote hat der Bürger - der zugleich zappt und surft - Schwierigkeiten, eine Wahl zu treffen. Es ist immer leichter, Kontakte zu dem zu knüpfen, was einem ähnelt. Die Lektüre verliert sich. Wir bekommen Informationen durch das Prisma der Videos im Internet, aus Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen, aus Kanälen, die wir abonnieren. Die Arena der Debatte implodiert durch die Explosion der Medien.
Es handelt sich sicher nur um eine Übergangszeit, die wir brauchen, um diese Unendlichkeit zu fassen. Aber in dieser Zeit weht der Wind gegen den Idealismus. Auf der Tagesordnung stehen nicht mehr die großen Entwürfe, sondern eher der Rückzug: ins Regionale, in die Community, den Clan, den Stamm, die Familie. Staatsnationen lösen sich auf, Balkanisierung droht. Und Joseph de Maistre, der konterrevolutionäre Philosoph bekommt seine Revanche. Er hatte sich bekanntlich über die Idee der universellen Menschenrechte lustig gemacht, die er zu abstrakt fand: "Der Mensch existiert nicht, ich habe nie einen gesehen... Ich habe in meinem Leben Franzosen, Russen, Italiener gesehen... Dank Montesquieu weiß ich sogar, dass man Perser sein kann." Diese Tirade zeigt, wo Universalismus immer schon am akutesten bedroht war: in der Überschätzung äußerlicher Unterschiede. Ob sie nun regional, sexuell, kulturell oder religiös sind. Nicht dass der Universalismus diese Unterschiede leugnet - er will sie überschreiten.
In den Vereinten Nationen berufen sich Staaten auf "nationale Umstände", um die Allgemeine Menschenrechtserklärung nicht in vollem Umfang anzuwenden. Und auf den Respekt für Religionen, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Im Namen des Antiimperialismus diffamieren linke Aktivisten den Universalismus als Neokolonialismus. Im Namen des Kampfes gegen Diskriminierung werden "ethnorassische" Bevölkerungskategorien definiert. Im Namen der Vielfalt kultiviert man das Trennende. Im Namen der Authentizität rehabilitiert man den Exotismus und nimmt den Anderen in entschieden antiuniversalistischer Weise als Objekt der Neugierde, statt als Seinesgleichen wahr. Und schließlich toleriert man im Namen der Toleranz die Intoleranten. Ohne Blick dafür, dass die kulturelle Ghettoisierung in dem Maß voranschreitet, wie die individuelle Freiheit zurückweicht. Isoliert betrachtet mag jede einzelne dieser Konzessionen als Einzelfall erscheinen. Zusammengenommen erscheinen sie als Bestandteile einer massiven Kapitulation.
Kanada, die Vereinigten Staaten, Südafrika, Australien, Indien, Belgien, Großbritannien, die Niederlande, Brasilien, Frankreich - all diese Länder stehen vor der gleichen Herausforderung... Überall wo der Respekt der Minderheiten und der Kult der Vielfalt voranschreiten, zerbricht man sich den Kopf über die Frage, wie man den Respekt für die Differenz mit der Aufrechterhaltung der gemeinsamen Werte vereinbaren soll. Lassen sich Bechneidung von Frauen oder Kindsmord im Namen der Sitte rechtfertigen? Steht der Respekt fürs Kopftuch über der Gleichheit von Mann und Frau? Soll man unterschiedliche Speisekarten an den Schulen einführen? Und getrennte Zeiten für Jungen und Mädchen in den Schwimmbädern? Sind Weihnachtsbäume auf öffentlichen Plätzen inopportun, weil sie religiöse Minderheiten beleidigen könnten? Sind zivilrechtliche Entscheidungen auf der Grundlage der Scharia zu akzeptieren?
Das Problem liegt weniger im Multikulturellen als in seiner philosophischen und politischen Formulierung: dem Multikulturalismus. Mit der möglichen Ausnahme Nordkoreas sind menschliche Gesellschaften seit langer Zeit aus Bürgern unterschiedlicher religiöser oder kultureller Herkunft zusammengesetzt. Vor der Entstehung eines antirassistischen Bewusstseins wurden Hierarchie und Herrschaft durch Zwang hergestellt. Aber im Lauf der Zeit brauchte diese Art der Herrschaft Alibis. Unter der Apartheid wie auch zur Zeit der Rassentrennung in den USA gab man vor, "gleich, aber getrennt" leben zu können. Diese Illusion ist zerstoben. Die Geschichte hat hinlänglich bewiesen, dass der Differenzialismus - also jene Lehre, die den anderen als so anders ansieht, dass man ihn nach anderen Kriterien behandelt und einschätzt - unvermeidlich in die Ungleichheit führt. Nun aber kommt der Kultur der Andersheit unter der gefälligeren Maske des Multikulturalismus und der Vielfalt zurück. Diesmal ist zumindest das Ansinnen nobel. Multikulturalismus heißt, Vielfalt zu feiern und Unterschiede zu respektieren. Wer sollte etwas dagegen haben? Die Schwierigkeiten beginnen, wenn man beides toleriert: kulturelle Bereicherungen, aber auch Regressionen gegenüber unseren gemeinsamen Werten. Diese Vermischung ist es, die die Ziele der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte untergräbt.
Der Antirassismus hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs enorme Fortschritte gemacht. Der Windhauch des Universalen half, Ideologien zu entlarven, Grenzen einzureißen, Tabus zu brechen, Diskriminierungen und Ungleichheiten abzubauen. Aber jede Bewegung neigt zum Exzess. Wie durch einen Pendelschlag entsteht eine neue Herausforderung. Im Namen des Antirassismus und des Rechts auf die Differenz fordern die intolerantesten Ideen wie Sexismus oder Fundamentalismus Toleranz und Respekt für Kulturen und Religionen. Zugleich trüben sich die Begriffe. Wann ist eine Bemerkung rassistisch, wann muss man sie als Debattenbeitrag akzeptieren? Was ist Kultur, was Politik, was der Anspruch einer Community und was Kommunitarismus, was Recht auf Gleichheit oder Bevorzugung? Verwirrung führt zu Übertreibung. Vor allem dann, wenn es sich um Forderungen im Namen des Islams handelt. Der Rückzug auf die Community antwortet auf den Rassismus, der Relativismus glaubt eine Kompensation anzubieten, indem er alles toleriert, sogar den Fundamentalismus... Falsche Duldsamkeit löst Ärger aus und führt zu Sehnsucht nach monokulturelleren Zeiten, in denen diese Probleme - glaubt man - noch nicht existierten. Ein Teufelskreis.
Mitten im Sturm erscheint die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen gemeinschaftlichen Werten und individuellen Freiheiten als eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. Sie schließt an eine alte Debatte an, in der sich seit langem die Verfechter des Rechts auf Differenz (ich erkenne deine Andersheit an, um dich besser als gleichen behandeln zu können) und die Anhänger des Rechts auf Indifferenz (Gleichheit heißt, dich so zu behandeln, als wärest du nicht anders, also ohne Unterschied) gegenüberstehen.
Diese Bruchlinie erklärt die andauernden Missverständnisse zwischen dem angelsächsischen und dem republikanisch-französischen Ansatz. Ich spreche bewusst von "Ansatz", um nicht das Bild allzu abgeschlossener "Modelle" vor Augen zu stellen. Sie sind nicht hermetisch und beeinflussen sich in einer globalisierten Welt gegenseitig. (...) Positive Diskriminierung, ethnische Statistiken, das französische Gesetz über religiöse Zeichen in öffentlichen Schulen, Laizismus. In all diesen Themen gibt es wirkliche Nuancen. Aus historischen und politischen Gründen. Aber diese Divergenzen sind nicht in Marmor gemeißelt. Kaum je stand das republikanische, aus der Revolution stammende Modell in Frankreich so sehr vor der Auflösung. Immer mehr Intellektuelle wollen den Multikulturalismus akklimatisieren und und die Laizität "öffnen". Auf höchster Staatsebene sucht man Inspiration in angelsächsischen Modellen. Im Ausland werden bestimmte Gesetze - wie das Gesetz über die religiösen Zeichen an öffentlichen Schulen - heftig kritisiert. Das französische Modell gilt als intolerant, rassistisch, veraltet und abgetan. Aber ist es so einfach?
Gleichzeitig verdunkelt sich auf der anderen Seite des Atlantiks oder des Ärmelkanals der strahlende Horizont von Multikulti. Immer mehr Stimmen machen auf seine perversen Effekte aufmerksam. Vor allem seit dem 11. September. Der Kult der Differenz, so der Vorwurf, spaltet, die Toleranz verblendet gegenüber der Gefahr des Fundamentalismus. Die Positionen haben dabei oft unerwartete Vertreter: Mitglieder der bürgerlichsten Mainstreamkultur zeigen sich aus postkolonialem schlechtem Gewissen nachgiebig gegenüber den Extremen, Bürger mit Migrationshintergrund flehen sie an, endlich aufzuwachen...
Am Kreuzungspunkt dieser Polemiken sucht alle Welt nach einem dritten Weg, nach einem toleranteren Modell der Integration und einem weniger naiven Multikulturalismus. Viele Autoren haben sich auf diese windungsreiche Strecke begeben. Ich selbst habe mich dem Thema über verschiedene persönliche Erfahrungen angenähert, die meinen Blick prägten.
Mein erster Kontakt mit dem "Universalismus" war eher unangenehm. Ich engagierte mich für den "Pacte civil de solidarite", ein Partnerschaftsversprechen, nicht ganz so verbindlich wie die Ehe, das in Frankreich sowohl homo- wie heterosexuellen Paaren offen steht. Der "Pakt" sollte Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung zurückdrängen. Die Gegner des Projekts beriefen sich immer wieder auf den "Universalismus", um den homosexuellen "Kommunitarismus" zurückzuweisen. Die derart gekidnappten Begriffe der Unversalität und des Republikanismus wurden so zu wahren Schimpfwörtern in den Augen der Minderheiten. Ich erinnere mich an Diskussionen mit Freunden von Act Up, die sich weigerten, das Wort "republikanisch" in einen Appell zu schreiben, den ich verfasst hatte. Dabei ging es darum, im Namen der von der Republik garantierten Gleichheit gegen die Anhänger eines katholischen und normativen Bilds von der Ehe anzugehen. Ich werde die erstaunten Mienen zweifelnder Kommissionsmitglieder bei einer Anhörung im Senat nicht vergessen, als ich darauf bestand, dass der "Pakt" einen Schritt zu mehr Universalität, und nicht in den Kommunitarismus bedeute. Mit Geduld und Pädagogik haben wir es geschafft zu beweisen, dass die Gegner des Rechts auf Gleichheit die eigentlichen Feinde des Universellen waren. Die Vorurteile sind gefallen wie nie. Diese Erfahrung hat mir die Vorzüge und Nachteile des französischen Modells vor Augen geführt.
Einige Jahre später stellten sich durch den 11. September ganz neue Fragen, und ich fand mich auf der anderen Seite der Front wieder. Nun warf man mir nicht mehr Kommunitarismus vor, sondern einen "Fundamentalismus der Republik und des Laizismus". Diesmal ging es darum, ein anderes Gesetz durchzusetzen, das auf der Linken sehr viel heftiger kritisiert wurde, das Gesetz zum Verbot der religiösen Zeichen an öffentlichen Schulen. Freunde, an deren Seite ich im Namen des Laizismus gegen den katholischen Fundamentalismus gekämpft hatte, fanden eben diesen Laizismus angesichts des Kopftuchs und des Islamismus plötzlich zweifelhaft... Wer hatte sich verändert? Unsere Standpunkte waren einfach nicht mehr die gleichen. Viele antirassistische Aktivisten nahmen die Debatte über das Kopftuch als einen Versuch wahr, Universalität und Republik zu instrumentalisieren, um die herrschende Norm zu festigen und einer minoritären Religion, dem Islam, zu schaden. Ich selbst arbeite lange genug über Fundamentalismen (ob christlich, jüdisch oder islamisch), um zwischen der Diskriminierung von Muslimen und einem laizistischen Kampf gegen Extremismus unterscheiden zu können. Als Frau und Feministin ist man überdies in der Kopftuchfrage vielleicht sensibler. Aber andere Feministinnen, die sich eher als Feindinnen des Imperialismus als des Fundamentalismus verstehen, sind anderer Meinung. Jeder Frau und jedem Mann die Emanzipation zu wünschen, ist für sie eine Art Neokolonialismus. Für mich handelt es sich darum, Gleichheit und Freiheit gegenüber den Betreibern einer moralischen Regression zu verteidigen, also um einen Kampf, der in allen Religionen und allen Kulturen auszufechten ist.
Von Neuem tat sich dieser Graben zur Zeit des Karikaturenstreits auf, als ich Journalistin bei Charlie Hebdo war. Ein denkwürdiger Sturm, in dem sich manche Position klärte... Meine größte Überraschung erlebte ich, als ich feststellen musste, wie tief ein Antirassismus "aus Reflex" jenseits jeder Kritik bei Jugendlichen verinnerlicht ist. Ich erinnere mich an einen Dialog der Taubstummen zwischen weltlich eingestellten Lehrern und ihren Schülern im Palais de Justice, am Tag als gegen Charlie Hebdo wegen Veröffentlichung der dänischen Karikaturen verhandelt wurde. Über einen Propheten zu lachen, ist für die Schüler an sich schon rassistisch. Sie machen überhaupt keinen Unterschied zwischen Spott über Religionen oder Überzeugungen und Verspottung von Individuen oder Gläubigen. Im Zweifel verzichten sie lieber auf eigenen Ideen, um nicht als "rassistisch" oder "islamophob" zu erscheinen. Und verfallen in eine Art Relativismus (ich kann über den anderen nicht urteilen, weil er anders ist), den den ich in meinem Empfinden des Antirassismus als rassistisch ansehe.
Zu diesem Begriff des Antirassismus haben mich unter anderem feministische Theoretikerinnnen wie Colette Guillaumin inspiriert, die auf Wesensvorstellungen beruhende Vorurteile über "Rasse" oder "Geschlecht" dekonstruierten. Dieser Widerstand gegen eine angebliche Naturordnung hat mich zum Widerstand gegen Fundamentalismen geführt. Hinzukam ein Antifaschismus, der sich gegen den Front national richtete, die erste politische Auseinandersetzung, in die ich mich stürzte. Allerdings weigere ich mich, mein Denken aus politischer Korrektheit allein an der extremen Rechten auszurichten. Als Journalistin, Autorin und Lehrende habe ich niemals irgendeine Arbeitshypothese a priori ausgeschlossen. Aber diese Freiheit in der Arbeit schließt eine Wachsamkeit gegen ihren Missbrauch ein. Ich wehre mich, wenn die Ergebnisse aus meinen Untersuchungen zum Fundamentalismus rassistische oder fremdenfeindliche Haltungen bemänteln sollen. Ich will Religion und Fundamentalismus, den ich als ihre Instrumentalisierung zu intoleranten Zwecken ansehe, unterscheiden...
Naivität existiert. Aber die Wachsamkeit rät, rassistischen Missbräuchen zuvorzukommen, indem man die Vernunft über die Leidenschaft stellt. Die Debatten in anderen Ländern zu beobachten, kann helfen, um Abstand zu gewinnen. Der Kurs über "Multikulturalismus und Universalismus", den ich seit nunmehr vier Jahren am Institut d"etudes politiques in Paris gebe, hat mir geholfen, meine Hypothesen an Studenten aus der ganzen Welt zu überprüfen: Australien, Kanada, Lateinamerika, Belgien, Russland, Italien, Hongkong, Tschechien, Vereinigte Staaten... Es ist beeindruckend, wie unterschiedlich Begriffe von Identität, Bürgerschaft oder Kultur gefasst werden können. Aber diese Diskussionen haben mich auch in dem Eindruck bestärkt, dass die kommenden Generationen den Multikulturalismus heilig halten, ohne ihn recht definieren zu können und unter Vermeidung bestimmter Fragen, die als intolerant erscheinen könnten. Diese wirre Ängstlichkeit findet sich in allen Altersstufen und in allen Gesellschaften. Ich bin ihr bei vielen Vorträgen im Ausland immer wieder begegnet. Überall bin ich auf die Ratlosigkeit von Bürgern, Vereinen und Politikern gestoßen. Wie sie habe ich das tiefe Bedürfnis, meine Ideen zu klären. In der Hoffnung antirassistisch sein zu können, ohne auf den kritischen Geist zu verzichten oder in einen Kulturrelativismus zu verfallen, der das Unduldbare duldet.
Caroline Fourest
****
Aus dem Französischen von Thierry Chervel
Kommentieren