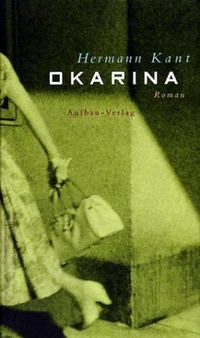Klappentext
Ausgehend von einer Fahrt in seine Heimatstadt Hamburg, lässt Hermann Kant die Leidenschaften und Irrtümer der 50er Jahre Revue passieren. Aus dem "Aufenthalt" kennt man diesen Niebuhr, der in polnischer Gefangenschaft von den Gräueltaten der Nazis und der Wehrmacht erfuhr. Jener Lebensabschnitt behält sein Gewicht auch für den Erzähler dieses Romans, zumal ihn seinerzeit Stalin in den Kreml holen ließ, zu seinem "Ideengefäß" ernannte und auf einer Okarina spielte - Flötentöne, die lange in Niebuhr nachhallen. Aber auch eine Begegnung mit Norma-Marilyn geht ihm nicht aus dem Kopf...
Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 21.08.2002
Rezensent Hans Christian Kosler kann sich nicht recht anfreunden mit Hermann Kants "Rechtfertigungsroman". Kant verwendet seine Erlebnisse in der DDR von 1947 bis zur Gegenwart als Grundlage und versetzt sie mit fiktiven Elementen. Daraus entsteht für den Rezensenten eine Mischung aus "beklemmender Zeitgeschichte" und "lächerlichen" wie "originellen" Szenen. Kants Versuch aber, dem Leser seine Stasi-Vergangenheit als Zufall und Fügung des Schicksals zu verkaufen, nimmt Kosler ihm nicht ab. Vereinzelte Gewissenbisse gebe es zwar, auch Beispiele von "Rechtfertigungsversuchen" oder Anflüge von Selbstmitleid", grundsätzlich aber demonstriere Kant seine "Unbelehrbarkeit". Kosler rechnet den Autor zu den "sprachmächtigsten und geistreichsten" Deutschlands, aber "seine Sprachverliebtheit und sein Gefallen am Wortspiel stehen ihm als Romancier im Wege". Kant kommt nie zum Punkt, moniert Kosler, und erst gegen Ende verzichte er auf jeden "Tüttelkram".
Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 21.03.2002
Schon der Beginn des Romans beschreibt auf langwierige Art eine Autofahrt, bei der der Erzähler ständig die Richtung wechselt. Nur zu symptomatisch ist das, bedauert Rezensentin Evelyn Finger, für den ganzen Roman, der in einer ziellosen "Zickzackfahrt" Autobiografisches und Fiktionales "bis zur Unlesbarkeit" vermischt - und es dennoch schafft, sich an allem, was die Geschichte interessant hätte machen können, vorbeizumogeln. Ständig gibt es unmotivierte politische Kommentare, klagt Finger, aber weder zur "politischen Satire" noch zur "Rechtfertigungsschrift" taugt das im Ganzen. Schwer auf die Nerven gegangen sind der Rezensentin einerseits des Autors allzu ausgeprägtes "Faible fürs Wortspiel", aber andererseits auch viele Anspielungen, die nirgends hinführen. Nur gelegentlich dürfe man sich hier daran erinnert fühlen, dass Kant "famos schreiben kann", denn zumeist tut er es in "Okarina" nicht. Das Ergebnis, so Fingers gnadenloses Verdikt, ist "spätsozialistischer Manierismus".
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 20.03.2002
Kristina Maidt-Zinke möchte die "Akte Kant" in ihrer Besprechung geschlossen lassen. Dennoch empfindet sie die Lektüre des Romans als "ungemein anstrengend", da die Sätze und Wörter die sichtbare Mühe erkennen lassen, immer wieder auf ihre Tauglichkeit abgeklopft zu werden. Die "in Jahrzehnten erworbene Praxis des Drumherumredens und Verklausulierens" könne der ehemalige Vorsitzende des DDR-Schriftstellerverbandes nicht mehr ablegen. Die Rezensentin attestiert ihm wohlwollend gute szenische Einfälle und einen "handfesten Erzählwitz". Doch hätten diese Einfälle gegenüber dem ständigen Rechtfertigungsdruck des Autors keine Chance. Die Entwicklung von Kants Helden, die Rezensentin nennt ihn boshaft einen historisch gewendeten Hans Albers, sowie das historische Geschehen berühren sie nicht. Selbst Erotisches zwinge der Autor "unter die Knute seiner Wortklaubereien". Der Rezensentin bleibt die Feststellung, wie schwer es der Sozialismus, vor allem der deutsche, mit der Sinnlichkeit hatte und wie wenig kurzweilig es ist, die Stalinsche Okarina-Flöte auf Ober- und Untertöne abzuhören.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deRezensionsnotiz zu Die Tageszeitung, 12.03.2002
Andre Meier hat nicht nur Hermann Kants neues Buch gelesen, er hat den Autor besucht. Dieser wohnt in seiner schlecht heizbaren Datsche im Mecklenburgischen, und es sieht dort genau so aus, wie es Kant in seinen letzten Romanen beschrieben hat, versichert Meier. Trist. Kant weiß nach wie vor die Leseerwartungen seiner Anhängerschaft zwischen Thüringen und Rostock zu erfüllen - und auch zu irritieren, so der Rezensent. Die Geschichte des Romans geht so, wie sie sich für Kant gehört: junger Wehrmachtsoffizier genießt nach Kriegsende russische Umerziehung sowie Stalins persönliche Aufmerksamkeit und wandelt sich "vom Wehrmachts-Saulus zum SED-Paulus". Diese Geschichte habe Kant im Grunde schon mehrfach erzählt, stellt Meier fest, man hält sie - nicht zu Unrecht - für Kants eigene Geschichte. Und doch lässt Kant seiner Meinung nach "Literatur und Leben nach Belieben zusammen- und auseinanderlaufen", so etwa, wenn im jüngsten Roman eine Stasi-Anwerbungsgespräch geschildert werde. Meier fühlt sich ertappt, als er Kant, dem man Spitzeltätigkeit nachsagt, aber nicht hat nachweisen können, darauf anspricht. Auf den Leim gegangen, sagt Meier - aber so genau weiß man oder weiß er es eben nicht. Kant sitzt jedenfalls in seiner Datsche, friert und feixt.
Themengebiete
Kommentieren