Der flüssige Spiegel
In Jean Cocteaus Film Orphee aus dem Jahr 1949 gelangt Orpheus auf der Suche nach Eurydike in die Unterwelt, indem er durch einen Spiegel aus Quecksilber schreitet. Die Szene ist ein meisterhaftes filmisches Zauberkunststück. Orpheus, gespielt von dem griechisch frisierten Jean Marais, wird zu einem großen Ankleidespiegel geführt. Er zieht Latexhandschuhe an, ein magisches Vorbereitungsritual, das nicht gänzlich die Tatsache verhüllt, dass Cocteau, der renommierte Avantgardekünstler, offenbar von einer ganz und gar modernen Sorge um Gesundheit und Sicherheit bewegt war. "Mit diesen Handschuhen werden Sie durch den Spiegel schreiten wie durch Wasser", erklärt Orpheus? Führer. "Die Hände zuerst." Zweifelnd tut Orpheus, wie ihm geheißen wurde, legt seine Handflächen auf die spiegelnde Oberfläche und stößt auf Widerstand - es ist eben ein Spiegel. "Il s?agit de croire", wird ihm geraten - Sie müssen glauben. Dann sehen wir in Großeinstellung seine Finger das Hindernis durchstoßen, dessen Oberfläche durch die verhängnisvolle Aktion in Bewegung gerät. Der Film wechselt in die Obersicht. Während die flüssige Spiegeloberfläche unserem Blick entzogen ist, entschwinden Orpheus und sein Führer durch das Portal.
Wir können die Unterwelt nicht kennen, bevor wir nicht selbst die Welt verlassen, und deshalb wählte Cocteau als Grenze zwischen beiden eine totale optische Barriere, die dennoch physisch durchdringbar war. Dem Vernehmen nach war für die Einstellung ein Behälter mit einer halben Tonne Quecksilber erforderlich. Das erscheint zunächst übertrieben, bis man sich erinnert, dass dieses Metall so dicht ist, dass Blei auf seiner Oberfläche schwimmt. Ein Behälter von diesem Gewicht und der Größe eines Ganzkörperspiegels wäre nicht sehr viel tiefer als einen Zentimeter. Aufrecht kann ein solcher Behälter natürlich nicht stehen, daher musste Cocteau seine Kamera um neunzig Grad kippen, um die Illusion eines vertikalen Spiegels zu erzeugen.
Der Künstler hätte vielleicht Milch oder Farbe verwenden können, um den gewünschten Effekt teilweise zu erreichen, aber Quecksilber war eine gute Wahl, denn es ist die einzige Flüssigkeit, die eine vollständige Reflexion ermöglicht. Nebenbei bot das Material einen zusätzlichen Vorteil. Cocteau erklärte später in einem Interview: "Im Quecksilber verschwinden die Hände, und die Geste ist mit einem gewissen Schauder verbunden. Bei Wasser wären dagegen kleine und größere kreisförmige Wellen entstanden. Obendrein hat Quecksilber einen elektrischen Widerstand."36 In dieser einen Handlung werden also Orpheus? Beklommenheit und Angst und die Anstrengung des Willens sichtbar, die er aufbieten muss, um das Leben zu verlassen. Überdies liefert die unvertraute, geradezu unnatürliche Eigenart des Quecksilbers deutliche Hinweise auf die Ungewissheiten, die in der übernatürlichen Welt zu erwarten sind.
Seit vielleicht fünftausend Jahren bekannt, wurde das Quecksilber seit jeher wegen des einzigartigen Zusammentreffens einer Flüssigkeit mit metallischen Eigenschaften gefeiert, auch wenn dies für jene, die nach einer Anwendung für das Zeug suchen, die Sache nicht einfacher gemacht hat. Für ein Material, das offensichtlich etwas Besonderes, zugleich aber ziemlich nutzlos ist, gibt es eine naheliegende Anwendung, nämlich in sakralen Riten. Cocteaus Benutzung des Quecksilbers als Tor zu einer anderen Welt ist nur eine moderne Wendung in einer alten und universellen Geschichte. Der erste Kaiser Chinas, Qin Shi Huangdi, der das Land im Jahr 221 v.u.Z. einte, soll der Legende zufolge unter einem rauen grünen Hügel bei Xi?an in der Provinz Shaanxi im Norden Chinas begraben sein. Der Historiker Sima Qian, der ein Jahrhundert nach dem Tod des Kaisers schrieb, berichtet von einer mit Bronze ausgekleideten Kammer, deren Decke mit Juwelen bestückt ist, die den Himmel darstellen soll; sie enthält ein phantastisches Modell des Palastes des Kaisers, seiner Hauptstadt Xianyang und seines ganzen Reiches. Durch die Modelllandschaft sollen sich Kanäle mit Quecksilber ziehen, die die hundert großen Flüsse Chinas repräsentieren. Man kann sich zwar nicht recht vorstellen, wie das realisiert wurde, aber Sima schreibt von Vorrichtungen, mit denen die schwere Flüssigkeit in dem System umhergepumpt wurde, so dass ihr stetiger Fluss das ewige Lebensblut des Kaisers symbolisierte. Es spricht im Übrigen einiges dafür, dass Qins Blut zum Zeitpunkt seines Todes tatsächlich Quecksilber enthielt, denn es wird vermutet, dass er Quecksilberpillen eingenommen hat, in der Hoffnung, Unsterblichkeit zu erlangen.
In derselben Region Chinas entdeckten Archäologen 1974 die inzwischen berühmt gewordene Terrakottaarmee, Hunderte von lebensgroßen Tonfiguren, zunächst Soldaten und später dann auch Musiker, Sportler und Beamte, was uns einen ungemein detaillierten Einblick in das Leben zu Beginn der Qin-Dynastie verschafft. Der Fundort wurde bald mit Beschreibungen der Landschaft in Simas Geschichtsschreibung abgeglichen, und man gelangte zu der Vermutung, dass sich unter einer bestimmten Anhöhe einige Kilometer weiter westlich das Grab des Kaisers verbergen könnte. Bei anschließenden Grabungen zeigte sich, dass die Gruben, in denen man die Terrakottaarmee gefunden hatte, zu einem ausgedehnten unterirdischen Komplex um dieses Phänomen herum gehörten, aber den Hügel selbst hat man noch nicht angerührt, weil man fürchtet, seine Inhalte - nicht zuletzt seine legendären Quecksilberströme - nicht erhalten zu können, wenn sie erst einmal aufgestöbert sind. Doch in der Umgebung wurden von Wissenschaftlern verschiedene Untersuchungen vorgenommen, darunter auch chemische Analysen von Bodenproben. In der unmittelbaren Nachbarschaft des Grabhügels wurden dabei weit über dem Normalwert liegende Quecksilbergehalte ermittelt. Nach Simas Darstellung wurde das unterirdische Modellreich genauestens an den realen geographischen Gegebenheiten ausgerichtet, und tatsächlich fand man einige der höchsten Konzentrationen von Quecksilber an den Stellen, die den Küstengewässern Chinas und den weiten Flächen des unteren Jangtse-Tals entsprechen.
Die Chinesen erhielten das Quecksilber-Metall ohne große Mühe aus dem reichlich vorhandenen roten Erz Zinnober, und dieses Pigment hat seinerseits die ganze Kultur in Gestalt des allgegenwärtigen Zinnoberrot durchdrungen, das als eine ausgesprochen glückbringende Farbe gilt. Zinnober wurde in Gräber gestreut, um den Wangen der Toten wieder ein wenig Farbe zu geben, und schon während der Shang-Dynastie 1600 Jahre v.u.Z. nutzte man es für die Herstellung der Tinte, mit der die in Gebein eingeritzten chinesischen Schriftzeichen gefärbt wurden. Das Metall selbst nutzte man als alternative Flüssigkeit zum Betrieb von Wasseruhren oder in mechanisierten Armillarsphären. Man nutzte es sogar zur Herstellung von Leitermännchen. "Die Chinesen haben Quecksilber und Zinnober wahrscheinlich ausgiebiger genutzt als jedes andere Volk", schrieb der große Sinologe Joseph Needham in seinem 24-bändigen Werk Wissenschaft und Zivilisation in China.37
Eine moderne Quecksilberkaskade mit ihrer eigenen Botschaft von Leben und Tod schuf Alexander Calder für den spanischen Pavillon auf der Pariser Weltausstellung von 1937. Der amerikanische Künstler erhielt den Auftrag indirekt von der kurzlebigen republikanischen Regierung während des spanischen Bürgerkriegs, und sein Quecksilberspringbrunnen wurde angemessen zur Schau gestellt in demselben Rahmen wie das dokumentarische Meisterwerk jener Jahre, Picassos Guernica. Calders Werk spielt nicht so offen auf den Konflikt an. Die mobile Skulptur besteht aus einer Reihe von drei Metallplatten, die über einem großen Teich aus Quecksilber angebracht sind. Das Quecksilber wird nach oben gepumpt, um in einem dünnen Strahl auf die oberste Platte herabzutröpfeln. Von dort fließt es in Tröpfchen und Rinnsalen rasch auf die Platten unterhalb, die es mit seinem Gewicht in kreiselnde Bewegungen versetzt und herabdrückt, bis es still in dem Teich verschwindet. Das Quecksilber ist der Schlüssel zum Verständnis des Werkes. Es kam, wie fast das gesamte Quecksilber der Welt zu jener Zeit, aus den Zinnoberlagerstätten von Almaden in der Provinz Ciudad Real südwestlich von Madrid. Dieses strategisch bedeutsame Vorkommen sollte von Francos Rebellen wiederholt belagert werden, und Calders Werk dient dem Gedenken der Bergleute, die den ersten Angriff der Nationalisten einige Monate zuvor erfolgreich abgewehrt hatten. In einem der einfallsreichsten Kriegsdenkmäler, das je ersonnen wurde, erkennen wir leuchtende Menschenleben, die sich zusammentun, sich trennen, größere Ereignisse gestalten, die ihrerseits ihr Schicksal bestimmen, bis sie zuletzt in die Stille eingehen.
Almaden ist ein Wort aus dem Arabischen und bedeutet "die Bergwerke", und dieser Ort war den Arabern, die vom 8. bis zum 15. Jahrhundert in Spanien regierten, wohlbekannt. Calders Springbrunnen trägt auch dieser Geschichte Rechnung. Im Jahr 936 ließ Kalif Abd ar-Rahman III. in Medina Azahara bei Cordoba, rund hundert Kilometer südlich von Almaden, einen persönlichen Landsitz errichten, einen üppigen Palast mitsamt Moschee und Gärten. Ein reizender Bestandteil dieses reich geschmückten alcazar oderSchlosses war ein Teich von Quecksilber, der aufgrund seiner Lage das Sonnenlicht in hellen Strahlen in den Raum reflektierte, in dem er sich befand. Die Gäste konnten ihre Finger in das Metall tauchen und dessen kühle, schmeichelnde Berührung genießen, und mit nur wenigen Bewegungen konnten sie wild tanzende Reflexe an der Decke auslösen, quasi eine Vorwegnahme der Discokugel. Zierteiche mit Quecksilber waren ein Merkmal des schwelgerischen islamischen Lebensstils, und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass man sie auch im präkolumbianischen Amerika kannte. Bevor man die Giftigkeit des Elements erkannte, war es naheliegend, dass man sich dort, wo es leicht zu gewinnen war, am Fließverhalten und der Tropfenbildung sowie am Glitzern der Flüssigkeit erfreute.
Der Quecksilberspringbrunnen wurde 1975 in den Räumen der Stiftung Joan Miro in Barcelona untergebracht und erhielt dort seine eigene verglaste Nische. Nun konnten die Besucher nicht mehr, wie sie es in Paris getan hatten, Münzen auf die Flüssigkeit werfen, um zu sehen, ob sie darauf schwimmen oder untergehen. Dass man dies den Besuchern 1937 gestattet hatte, zeugt von einer laxen Einstellung zur öffentlichen Gesundheit. Von den zweihundert Litern Quecksilber, die am Nachmittag der Eröffnung des spanischen Pavillons für die Presse aus Almaden eintrafen (Calder hatte während der Arbeit an seinem Werk Kugellagerkugeln aus Stahl benutzt, um das Funktionieren des Mobiles zu simulieren), sollten auf Anweisung Calders sage und schreibe fünfzig Liter in Reserve gehalten werden, um für Verluste durch Plätschern und Undichtigkeiten während der Dauer der Ausstellung vorzusorgen. Die toxischen Wirkungen des Quecksilbers, vertraut als Berufsrisiko von Hutmachern und anderen, die Quecksilberverbindungen bei ihrer Arbeit benutzten, machen sich bemerkbar, wenn es durch die Haut aufgenommen wird oder als Dampf in die Lunge eindringt. Doch für die Bewunderer von Calders Kunst gab es noch nicht einmal eine so elementare Vorsichtsmaßnahme wie Cocteaus Latexhandschuhe.
Dass man den Quecksilberspringbrunnen in Barcelona unter Quarantäne gestellt hat, ist symptomatisch für den heutigen Umgang mit dem Metall. Zunächst Schmuckelement und mystisches Wunder, fand das Quecksilber später zahlreiche Verwendungen, die sich seine ungewöhnliche Kombination von Eigenschaften zunutze machten: Dichte, Flüssigkeit, Leitfähigkeit. Seine Verbindungen wurden als Pigmente und Kosmetika benutzt; viele eignen sich wegen ihrer Giftigkeit als Insektizide und als Mittel, die den Anwuchs an Schiffen verhindern. In der Medizin waren sie Bestandteile aller erdenklichen Heilmittel, von drastischen Medikamenten gegen die Syphilis über ganz gewöhnliche Abführmittel bis zu Antiseptika wie Mercurochrom. Doch all diese und viele weitere Anwendungen sind inzwischen in Ungnade gefallen. In Norwegen gilt seit dem 1. Januar 2008 ein Verbot der Einfuhr und Herstellung von Dingen, die Quecksilber enthalten, darunter auch das Anfertigen von Zahnfüllungen mit Amalgam. In der Europäischen Union soll ab Juli 2011 ein Ausfuhrverbot für Quecksilber greifen; dadurch soll weltweit die Gefährdung durch dieses Element verringert werden. Quecksilberthermometer und -barometer werden dann zu historischen Relikten. Almaden hat nach über zweitausend Betriebsjahren die Förderung eingestellt. Auch das bereits in Umlauf befindliche Quecksilber gibt Anlass zur Sorge: In einer britischen Untersuchung über die Feuerbestattung wurde die Befürchtung geäußert, dass das Element in die Umwelt entweicht, wenn die Zahnfüllungen der Verstorbenen verdampfen - das Gespenst unseres einst leichtfertigen Umgangs mit dem Metall kehrt zurück und macht uns zu schaffen.
Bald werden vielleicht nur noch ganz spezielle Anwendungen übrig bleiben, wenngleich es ein gewisser Trost ist, dass die eine oder andere uns das surreale Vergnügen an älteren Quecksilber-Belustigungen zurückbringen mag. In den Bergen von British Columbia unweit von Vancouver steht das Large Zenith Telescope, das seine Bilder vom Himmel mit einem flüssigen Spiegel erhält. Das Quecksilber wird in eine Schale von sechs Metern Durchmesser gegossen, die einem Wok ähnelt. Durch langsame, gleichmäßige Rotation der Schale wird das Quecksilber in eine Parabelform gezwungen, die perfekter ist, als man es mit festem Glas oder Aluminium erreichen könnte. Die Idee gibt es seit über einem Jahrhundert, aber erst in jüngster Zeit, während das Metall anderwärts in Verruf geriet, wurde es möglich, einen Mechanismus zu schaffen, der hinreichend gleichmäßig läuft, um mit einem solchen Quecksilbertümpel scharfe Bilder zu erzeugen.
Viele chemische Verfahren, die den Alchemisten wohlbekannt waren, befinden sich heute außerhalb der Grenzen üblicher wissenschaftlicher Praxis, nicht weil sie besonders kompliziert oder undurchsichtig wären, sondern weil sie als so gefährlich gelten, dass die modernen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze es nicht gestatten, sie selbst mit all den Sicherheitsvorkehrungen eines modernen Labors anzuwenden. Eines dieser Verfahren ist die reversible Verbindung von Quecksilber und Schwefel, eine Reaktion, die einst für die alchemistische Theorie von zentraler Bedeutung war. Das Interesse der Alchemisten an dieser einfachen Reaktion ist leicht zu erklären. Indem sie den gelben Schwefel, der trocken und heiß ist, mit dem flüssigen Quecksilber, das sich kühl und feucht anfühlt, verbanden, brachten
sie die vier Prinzipien jeglicher Materie zusammen.
Überdies suggerierten die Farbe des Schwefels und der helle Schimmer des Quecksilbers, dass aus der Fusion Gold entstehen könnte. Die Alchemisten glaubten, sämtliche Metallvorkommen in der Erde seien auf dem Weg, zu Gold zu werden; wenn jemand stattdessen Zinn oder Blei fand, war er einfach zu früh gekommen. Quecksilber und Schwefel, die beide häufig in gediegenem Zustand vorkommen, schienen mit ihrem vielversprechenden Aussehen einen schnelleren Weg zu diesem Ziel zu bieten. Dschabir ibn Hayyan (sein Name erscheint oft in latinisierter Form als Geber), der große arabische Alchemist und Mystiker des 8. Jahrhunderts, dem es möglicherweise zu verdanken ist, dass chinesisches Wissen über Zinnober und Quecksilber in den Westen gelangte, war überzeugt, dass Vollkommenheit in Metallen, ob sie nun in der Natur gefunden oder vom Menschen gemacht wurden, nur zu erreichen war, wenn diese beiden Elemente im richtigen Verhältnis und mit der richtigen Temperatur präsent waren. Mangelnde Vollkommenheit - also das Auffinden unedlen Metalls, wo man auf Gold gehofft hatte - wurde einfach als ein Missverhältnis dieser Faktoren erklärt. Nach Dschabirs Ansicht entstanden die kostbareren Metalle dadurch, dass man für einen größeren Anteil Quecksilber sorgte.
So weit die Theorie. Versuche verliefen natürlich enttäuschend, wenngleich es einigen zwielichtigen Praktikern gelang, Leichtgläubigen einzureden, sie hätten zumindest die Menge ihres vorhandenen Goldes vermehrt - dabei wird der Schwefel verbrannt sein, während das Quecksilber sich mit dem Gold durch Amalgamieren vereinte und eine scheinbare Gewichtszunahme ergab, aber natürlich nicht mehr Gold. Statt nun angesichts dieser unbefriedigenden Ergebnisse von ihrer Hoffnung zu lassen, verfeinerten die Alchemisten Dschabirs Theorie um den Hinweis, man könne zusätzlich zum Gold alle möglichen Metalle hervorbringen, indem man mit der relativen Menge dieser beiden Elemente jongliert. Diese Reaktion stand daher im Mittelpunkt der etablierten Wissenschaft des mittelalterlichen Europa, und sie bildete noch mehrere Jahrhunderte lang das Kernstück des alchemistischen Denkens. Ein Text aus dem frühen 17. Jahrhundert zeigt eine Gravur von Thomas von Aquin, der in der Art eines Fremdenführers auf einen zwecks Veranschaulichung aufgeschnittenen und mit Grassoden bedeckten Ofen deutet, in dem sich die Dämpfe zweier Elemente vermengen. "So wie die Natur aus Schwefel und Quecksilber Metalle hervorbringt, so auch die Kunst", heißt es in der Bildunterschrift.38 Diese Reaktion wurde zwar auf der Grundlage eines irrigen Glaubens durchgeführt, stellte aber dennoch einen Wendepunkt auf dem Weg zur modernen Chemie dar. Sie war wohl der erste Fall einer auf Kenntnissen basierenden Synthese einer neuen Substanz aus zwei bekannten Bestandteilen. Außerdem war sie die erste eindeutige Demonstration der Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen - Quecksilber verbindet sich nämlich nicht nur leicht mit Schwefel zu Quecksilbersulphid (Zinnober), sondern das Quecksilbersulphid zerfällt, wenn man es erhitzt, auch wieder in seine beiden Bestandteile. So lieferte sie einen bedeutenden Hinweis darauf, dass Materie weder erschaffen noch zerstört werden kann.
Das Experiment ist nicht schwierig. Ich könnte das Quecksilber aus einem alten Thermometer verwenden, es in einen Schmelztiegel tun, eine entsprechende Menge Schwefel hineinmischen, das Ganze abdecken und erhitzen, bis die satte zinnoberrote Farbe von Quecksilbersulphid hervorträte.
Ich könnte es nochmals erhitzen, um diese beiden konstituierenden Elemente wieder zu trennen, und dann das Quecksilber abdestillieren, während der Schwefel verbrennt. Nun halte ich zwar die groß herausgestellten Gefahren der vielen chemischen Experimente, von deren Durchführung zu Hause heutzutage dringend abgeraten wird, für übertrieben, doch heute ist mir klar, dass Quecksilberdampf ein höchst unangenehmes Zeug ist - was ich nicht wusste, als ich mein Quecksilber durch Erhitzen von Batterien gewann.
Ich gebe mich damit zufrieden, das Experiment mit Hilfe von Marcos Martinon-Torres am University College London aus einiger Entfernung zu beobachten. Marcos hat sich eine akademische Laufbahn an der Schnittstelle zwischen Archäologie und Materialwissenschaft erkämpft, die ihm einen wundervollen Vorwand liefert, die Experimente der Alchemisten im Interesse der historischen Genauigkeit nachzustellen. Doch als es darum ging, das Quecksilber-Schwefel-Experiment zu wiederholen, wurde selbst er aus den Laboratorien seines Instituts verbannt und genötigt, sich in ein geheim gehaltenes Feld irgendwo in den Vororten zu verziehen.
Das Reaktionsgefäß ist ein tönernes Aludel - ein arabisches Wort wie so viele in der Chemie -, eine Art Schmelztiegel mit einem hohen spitzen Deckel, ähnlich einem Hexenhut, wo sich Dämpfe vermischen und abkühlen können. Der Apparat hat ungefähr die Größe und Form eines Straußeneis. Ein kleines Luftloch oben verhindert, dass innerhalb des Geräts der Druck zunimmt und eine Explosion verursacht. Marcos und Nicolas Thomas, ein anderer Kollege von der Pariser Universität Pantheon-Sorbonne, besprengen den Zinnober, den sie unten in dem Gefäß eingebracht haben, setzen den Hut obendrauf und schließen das Ganze mit feuchtem Ton luftdicht ab. Dann bauen sie aus Ziegelsteinen und Ton einen kleinen Ofen, füllen diesen mit Holzkohle und stecken sie an. Wenn sie meinen, es sei heiß genug, um den Zinnober zu zersetzen, aber noch nicht so heiß, dass das Quecksilber als Dampf entweicht, stellen sie den Aludel in den Ofen. Mit Atemgeräten hocken sie sich daneben und beobachten aufmerksam den Aludel, der sich von der Gluthitze des Feuers allmählich erwärmt. Erleichtert darüber, dass er nicht explodiert ist, beobachten sie bald kleine Tröpfchen Quecksilber, die sich rings um das Entlüftungsloch niedergeschlagen haben. Daran erkennt man, dass die Reaktion stattgefunden hat. Nachdem das Gerät abgekühlt ist, öffnen sie es. Ein Sternenzelt winziger schimmernder Kügelchen hat sich an der Innenwand abgesetzt. Sie sammeln das Quecksilber ein, setzen Schwefel hinzu und erhitzen das Ganze erneut. Dabei erhalten sie wieder den Zinnober, ein Durcheinander von Gelb und Rot, teils fest, teils geschmolzen, das für jedermann wie ein gedämpfter Melassepudding aussieht, aber höllisch riecht.
zu Teil 2
In Jean Cocteaus Film Orphee aus dem Jahr 1949 gelangt Orpheus auf der Suche nach Eurydike in die Unterwelt, indem er durch einen Spiegel aus Quecksilber schreitet. Die Szene ist ein meisterhaftes filmisches Zauberkunststück. Orpheus, gespielt von dem griechisch frisierten Jean Marais, wird zu einem großen Ankleidespiegel geführt. Er zieht Latexhandschuhe an, ein magisches Vorbereitungsritual, das nicht gänzlich die Tatsache verhüllt, dass Cocteau, der renommierte Avantgardekünstler, offenbar von einer ganz und gar modernen Sorge um Gesundheit und Sicherheit bewegt war. "Mit diesen Handschuhen werden Sie durch den Spiegel schreiten wie durch Wasser", erklärt Orpheus? Führer. "Die Hände zuerst." Zweifelnd tut Orpheus, wie ihm geheißen wurde, legt seine Handflächen auf die spiegelnde Oberfläche und stößt auf Widerstand - es ist eben ein Spiegel. "Il s?agit de croire", wird ihm geraten - Sie müssen glauben. Dann sehen wir in Großeinstellung seine Finger das Hindernis durchstoßen, dessen Oberfläche durch die verhängnisvolle Aktion in Bewegung gerät. Der Film wechselt in die Obersicht. Während die flüssige Spiegeloberfläche unserem Blick entzogen ist, entschwinden Orpheus und sein Führer durch das Portal.
Wir können die Unterwelt nicht kennen, bevor wir nicht selbst die Welt verlassen, und deshalb wählte Cocteau als Grenze zwischen beiden eine totale optische Barriere, die dennoch physisch durchdringbar war. Dem Vernehmen nach war für die Einstellung ein Behälter mit einer halben Tonne Quecksilber erforderlich. Das erscheint zunächst übertrieben, bis man sich erinnert, dass dieses Metall so dicht ist, dass Blei auf seiner Oberfläche schwimmt. Ein Behälter von diesem Gewicht und der Größe eines Ganzkörperspiegels wäre nicht sehr viel tiefer als einen Zentimeter. Aufrecht kann ein solcher Behälter natürlich nicht stehen, daher musste Cocteau seine Kamera um neunzig Grad kippen, um die Illusion eines vertikalen Spiegels zu erzeugen.
Der Künstler hätte vielleicht Milch oder Farbe verwenden können, um den gewünschten Effekt teilweise zu erreichen, aber Quecksilber war eine gute Wahl, denn es ist die einzige Flüssigkeit, die eine vollständige Reflexion ermöglicht. Nebenbei bot das Material einen zusätzlichen Vorteil. Cocteau erklärte später in einem Interview: "Im Quecksilber verschwinden die Hände, und die Geste ist mit einem gewissen Schauder verbunden. Bei Wasser wären dagegen kleine und größere kreisförmige Wellen entstanden. Obendrein hat Quecksilber einen elektrischen Widerstand."36 In dieser einen Handlung werden also Orpheus? Beklommenheit und Angst und die Anstrengung des Willens sichtbar, die er aufbieten muss, um das Leben zu verlassen. Überdies liefert die unvertraute, geradezu unnatürliche Eigenart des Quecksilbers deutliche Hinweise auf die Ungewissheiten, die in der übernatürlichen Welt zu erwarten sind.
Seit vielleicht fünftausend Jahren bekannt, wurde das Quecksilber seit jeher wegen des einzigartigen Zusammentreffens einer Flüssigkeit mit metallischen Eigenschaften gefeiert, auch wenn dies für jene, die nach einer Anwendung für das Zeug suchen, die Sache nicht einfacher gemacht hat. Für ein Material, das offensichtlich etwas Besonderes, zugleich aber ziemlich nutzlos ist, gibt es eine naheliegende Anwendung, nämlich in sakralen Riten. Cocteaus Benutzung des Quecksilbers als Tor zu einer anderen Welt ist nur eine moderne Wendung in einer alten und universellen Geschichte. Der erste Kaiser Chinas, Qin Shi Huangdi, der das Land im Jahr 221 v.u.Z. einte, soll der Legende zufolge unter einem rauen grünen Hügel bei Xi?an in der Provinz Shaanxi im Norden Chinas begraben sein. Der Historiker Sima Qian, der ein Jahrhundert nach dem Tod des Kaisers schrieb, berichtet von einer mit Bronze ausgekleideten Kammer, deren Decke mit Juwelen bestückt ist, die den Himmel darstellen soll; sie enthält ein phantastisches Modell des Palastes des Kaisers, seiner Hauptstadt Xianyang und seines ganzen Reiches. Durch die Modelllandschaft sollen sich Kanäle mit Quecksilber ziehen, die die hundert großen Flüsse Chinas repräsentieren. Man kann sich zwar nicht recht vorstellen, wie das realisiert wurde, aber Sima schreibt von Vorrichtungen, mit denen die schwere Flüssigkeit in dem System umhergepumpt wurde, so dass ihr stetiger Fluss das ewige Lebensblut des Kaisers symbolisierte. Es spricht im Übrigen einiges dafür, dass Qins Blut zum Zeitpunkt seines Todes tatsächlich Quecksilber enthielt, denn es wird vermutet, dass er Quecksilberpillen eingenommen hat, in der Hoffnung, Unsterblichkeit zu erlangen.
In derselben Region Chinas entdeckten Archäologen 1974 die inzwischen berühmt gewordene Terrakottaarmee, Hunderte von lebensgroßen Tonfiguren, zunächst Soldaten und später dann auch Musiker, Sportler und Beamte, was uns einen ungemein detaillierten Einblick in das Leben zu Beginn der Qin-Dynastie verschafft. Der Fundort wurde bald mit Beschreibungen der Landschaft in Simas Geschichtsschreibung abgeglichen, und man gelangte zu der Vermutung, dass sich unter einer bestimmten Anhöhe einige Kilometer weiter westlich das Grab des Kaisers verbergen könnte. Bei anschließenden Grabungen zeigte sich, dass die Gruben, in denen man die Terrakottaarmee gefunden hatte, zu einem ausgedehnten unterirdischen Komplex um dieses Phänomen herum gehörten, aber den Hügel selbst hat man noch nicht angerührt, weil man fürchtet, seine Inhalte - nicht zuletzt seine legendären Quecksilberströme - nicht erhalten zu können, wenn sie erst einmal aufgestöbert sind. Doch in der Umgebung wurden von Wissenschaftlern verschiedene Untersuchungen vorgenommen, darunter auch chemische Analysen von Bodenproben. In der unmittelbaren Nachbarschaft des Grabhügels wurden dabei weit über dem Normalwert liegende Quecksilbergehalte ermittelt. Nach Simas Darstellung wurde das unterirdische Modellreich genauestens an den realen geographischen Gegebenheiten ausgerichtet, und tatsächlich fand man einige der höchsten Konzentrationen von Quecksilber an den Stellen, die den Küstengewässern Chinas und den weiten Flächen des unteren Jangtse-Tals entsprechen.
Die Chinesen erhielten das Quecksilber-Metall ohne große Mühe aus dem reichlich vorhandenen roten Erz Zinnober, und dieses Pigment hat seinerseits die ganze Kultur in Gestalt des allgegenwärtigen Zinnoberrot durchdrungen, das als eine ausgesprochen glückbringende Farbe gilt. Zinnober wurde in Gräber gestreut, um den Wangen der Toten wieder ein wenig Farbe zu geben, und schon während der Shang-Dynastie 1600 Jahre v.u.Z. nutzte man es für die Herstellung der Tinte, mit der die in Gebein eingeritzten chinesischen Schriftzeichen gefärbt wurden. Das Metall selbst nutzte man als alternative Flüssigkeit zum Betrieb von Wasseruhren oder in mechanisierten Armillarsphären. Man nutzte es sogar zur Herstellung von Leitermännchen. "Die Chinesen haben Quecksilber und Zinnober wahrscheinlich ausgiebiger genutzt als jedes andere Volk", schrieb der große Sinologe Joseph Needham in seinem 24-bändigen Werk Wissenschaft und Zivilisation in China.37
Eine moderne Quecksilberkaskade mit ihrer eigenen Botschaft von Leben und Tod schuf Alexander Calder für den spanischen Pavillon auf der Pariser Weltausstellung von 1937. Der amerikanische Künstler erhielt den Auftrag indirekt von der kurzlebigen republikanischen Regierung während des spanischen Bürgerkriegs, und sein Quecksilberspringbrunnen wurde angemessen zur Schau gestellt in demselben Rahmen wie das dokumentarische Meisterwerk jener Jahre, Picassos Guernica. Calders Werk spielt nicht so offen auf den Konflikt an. Die mobile Skulptur besteht aus einer Reihe von drei Metallplatten, die über einem großen Teich aus Quecksilber angebracht sind. Das Quecksilber wird nach oben gepumpt, um in einem dünnen Strahl auf die oberste Platte herabzutröpfeln. Von dort fließt es in Tröpfchen und Rinnsalen rasch auf die Platten unterhalb, die es mit seinem Gewicht in kreiselnde Bewegungen versetzt und herabdrückt, bis es still in dem Teich verschwindet. Das Quecksilber ist der Schlüssel zum Verständnis des Werkes. Es kam, wie fast das gesamte Quecksilber der Welt zu jener Zeit, aus den Zinnoberlagerstätten von Almaden in der Provinz Ciudad Real südwestlich von Madrid. Dieses strategisch bedeutsame Vorkommen sollte von Francos Rebellen wiederholt belagert werden, und Calders Werk dient dem Gedenken der Bergleute, die den ersten Angriff der Nationalisten einige Monate zuvor erfolgreich abgewehrt hatten. In einem der einfallsreichsten Kriegsdenkmäler, das je ersonnen wurde, erkennen wir leuchtende Menschenleben, die sich zusammentun, sich trennen, größere Ereignisse gestalten, die ihrerseits ihr Schicksal bestimmen, bis sie zuletzt in die Stille eingehen.
Almaden ist ein Wort aus dem Arabischen und bedeutet "die Bergwerke", und dieser Ort war den Arabern, die vom 8. bis zum 15. Jahrhundert in Spanien regierten, wohlbekannt. Calders Springbrunnen trägt auch dieser Geschichte Rechnung. Im Jahr 936 ließ Kalif Abd ar-Rahman III. in Medina Azahara bei Cordoba, rund hundert Kilometer südlich von Almaden, einen persönlichen Landsitz errichten, einen üppigen Palast mitsamt Moschee und Gärten. Ein reizender Bestandteil dieses reich geschmückten alcazar oderSchlosses war ein Teich von Quecksilber, der aufgrund seiner Lage das Sonnenlicht in hellen Strahlen in den Raum reflektierte, in dem er sich befand. Die Gäste konnten ihre Finger in das Metall tauchen und dessen kühle, schmeichelnde Berührung genießen, und mit nur wenigen Bewegungen konnten sie wild tanzende Reflexe an der Decke auslösen, quasi eine Vorwegnahme der Discokugel. Zierteiche mit Quecksilber waren ein Merkmal des schwelgerischen islamischen Lebensstils, und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass man sie auch im präkolumbianischen Amerika kannte. Bevor man die Giftigkeit des Elements erkannte, war es naheliegend, dass man sich dort, wo es leicht zu gewinnen war, am Fließverhalten und der Tropfenbildung sowie am Glitzern der Flüssigkeit erfreute.
Der Quecksilberspringbrunnen wurde 1975 in den Räumen der Stiftung Joan Miro in Barcelona untergebracht und erhielt dort seine eigene verglaste Nische. Nun konnten die Besucher nicht mehr, wie sie es in Paris getan hatten, Münzen auf die Flüssigkeit werfen, um zu sehen, ob sie darauf schwimmen oder untergehen. Dass man dies den Besuchern 1937 gestattet hatte, zeugt von einer laxen Einstellung zur öffentlichen Gesundheit. Von den zweihundert Litern Quecksilber, die am Nachmittag der Eröffnung des spanischen Pavillons für die Presse aus Almaden eintrafen (Calder hatte während der Arbeit an seinem Werk Kugellagerkugeln aus Stahl benutzt, um das Funktionieren des Mobiles zu simulieren), sollten auf Anweisung Calders sage und schreibe fünfzig Liter in Reserve gehalten werden, um für Verluste durch Plätschern und Undichtigkeiten während der Dauer der Ausstellung vorzusorgen. Die toxischen Wirkungen des Quecksilbers, vertraut als Berufsrisiko von Hutmachern und anderen, die Quecksilberverbindungen bei ihrer Arbeit benutzten, machen sich bemerkbar, wenn es durch die Haut aufgenommen wird oder als Dampf in die Lunge eindringt. Doch für die Bewunderer von Calders Kunst gab es noch nicht einmal eine so elementare Vorsichtsmaßnahme wie Cocteaus Latexhandschuhe.
Dass man den Quecksilberspringbrunnen in Barcelona unter Quarantäne gestellt hat, ist symptomatisch für den heutigen Umgang mit dem Metall. Zunächst Schmuckelement und mystisches Wunder, fand das Quecksilber später zahlreiche Verwendungen, die sich seine ungewöhnliche Kombination von Eigenschaften zunutze machten: Dichte, Flüssigkeit, Leitfähigkeit. Seine Verbindungen wurden als Pigmente und Kosmetika benutzt; viele eignen sich wegen ihrer Giftigkeit als Insektizide und als Mittel, die den Anwuchs an Schiffen verhindern. In der Medizin waren sie Bestandteile aller erdenklichen Heilmittel, von drastischen Medikamenten gegen die Syphilis über ganz gewöhnliche Abführmittel bis zu Antiseptika wie Mercurochrom. Doch all diese und viele weitere Anwendungen sind inzwischen in Ungnade gefallen. In Norwegen gilt seit dem 1. Januar 2008 ein Verbot der Einfuhr und Herstellung von Dingen, die Quecksilber enthalten, darunter auch das Anfertigen von Zahnfüllungen mit Amalgam. In der Europäischen Union soll ab Juli 2011 ein Ausfuhrverbot für Quecksilber greifen; dadurch soll weltweit die Gefährdung durch dieses Element verringert werden. Quecksilberthermometer und -barometer werden dann zu historischen Relikten. Almaden hat nach über zweitausend Betriebsjahren die Förderung eingestellt. Auch das bereits in Umlauf befindliche Quecksilber gibt Anlass zur Sorge: In einer britischen Untersuchung über die Feuerbestattung wurde die Befürchtung geäußert, dass das Element in die Umwelt entweicht, wenn die Zahnfüllungen der Verstorbenen verdampfen - das Gespenst unseres einst leichtfertigen Umgangs mit dem Metall kehrt zurück und macht uns zu schaffen.
Bald werden vielleicht nur noch ganz spezielle Anwendungen übrig bleiben, wenngleich es ein gewisser Trost ist, dass die eine oder andere uns das surreale Vergnügen an älteren Quecksilber-Belustigungen zurückbringen mag. In den Bergen von British Columbia unweit von Vancouver steht das Large Zenith Telescope, das seine Bilder vom Himmel mit einem flüssigen Spiegel erhält. Das Quecksilber wird in eine Schale von sechs Metern Durchmesser gegossen, die einem Wok ähnelt. Durch langsame, gleichmäßige Rotation der Schale wird das Quecksilber in eine Parabelform gezwungen, die perfekter ist, als man es mit festem Glas oder Aluminium erreichen könnte. Die Idee gibt es seit über einem Jahrhundert, aber erst in jüngster Zeit, während das Metall anderwärts in Verruf geriet, wurde es möglich, einen Mechanismus zu schaffen, der hinreichend gleichmäßig läuft, um mit einem solchen Quecksilbertümpel scharfe Bilder zu erzeugen.
Viele chemische Verfahren, die den Alchemisten wohlbekannt waren, befinden sich heute außerhalb der Grenzen üblicher wissenschaftlicher Praxis, nicht weil sie besonders kompliziert oder undurchsichtig wären, sondern weil sie als so gefährlich gelten, dass die modernen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze es nicht gestatten, sie selbst mit all den Sicherheitsvorkehrungen eines modernen Labors anzuwenden. Eines dieser Verfahren ist die reversible Verbindung von Quecksilber und Schwefel, eine Reaktion, die einst für die alchemistische Theorie von zentraler Bedeutung war. Das Interesse der Alchemisten an dieser einfachen Reaktion ist leicht zu erklären. Indem sie den gelben Schwefel, der trocken und heiß ist, mit dem flüssigen Quecksilber, das sich kühl und feucht anfühlt, verbanden, brachten
sie die vier Prinzipien jeglicher Materie zusammen.
Überdies suggerierten die Farbe des Schwefels und der helle Schimmer des Quecksilbers, dass aus der Fusion Gold entstehen könnte. Die Alchemisten glaubten, sämtliche Metallvorkommen in der Erde seien auf dem Weg, zu Gold zu werden; wenn jemand stattdessen Zinn oder Blei fand, war er einfach zu früh gekommen. Quecksilber und Schwefel, die beide häufig in gediegenem Zustand vorkommen, schienen mit ihrem vielversprechenden Aussehen einen schnelleren Weg zu diesem Ziel zu bieten. Dschabir ibn Hayyan (sein Name erscheint oft in latinisierter Form als Geber), der große arabische Alchemist und Mystiker des 8. Jahrhunderts, dem es möglicherweise zu verdanken ist, dass chinesisches Wissen über Zinnober und Quecksilber in den Westen gelangte, war überzeugt, dass Vollkommenheit in Metallen, ob sie nun in der Natur gefunden oder vom Menschen gemacht wurden, nur zu erreichen war, wenn diese beiden Elemente im richtigen Verhältnis und mit der richtigen Temperatur präsent waren. Mangelnde Vollkommenheit - also das Auffinden unedlen Metalls, wo man auf Gold gehofft hatte - wurde einfach als ein Missverhältnis dieser Faktoren erklärt. Nach Dschabirs Ansicht entstanden die kostbareren Metalle dadurch, dass man für einen größeren Anteil Quecksilber sorgte.
So weit die Theorie. Versuche verliefen natürlich enttäuschend, wenngleich es einigen zwielichtigen Praktikern gelang, Leichtgläubigen einzureden, sie hätten zumindest die Menge ihres vorhandenen Goldes vermehrt - dabei wird der Schwefel verbrannt sein, während das Quecksilber sich mit dem Gold durch Amalgamieren vereinte und eine scheinbare Gewichtszunahme ergab, aber natürlich nicht mehr Gold. Statt nun angesichts dieser unbefriedigenden Ergebnisse von ihrer Hoffnung zu lassen, verfeinerten die Alchemisten Dschabirs Theorie um den Hinweis, man könne zusätzlich zum Gold alle möglichen Metalle hervorbringen, indem man mit der relativen Menge dieser beiden Elemente jongliert. Diese Reaktion stand daher im Mittelpunkt der etablierten Wissenschaft des mittelalterlichen Europa, und sie bildete noch mehrere Jahrhunderte lang das Kernstück des alchemistischen Denkens. Ein Text aus dem frühen 17. Jahrhundert zeigt eine Gravur von Thomas von Aquin, der in der Art eines Fremdenführers auf einen zwecks Veranschaulichung aufgeschnittenen und mit Grassoden bedeckten Ofen deutet, in dem sich die Dämpfe zweier Elemente vermengen. "So wie die Natur aus Schwefel und Quecksilber Metalle hervorbringt, so auch die Kunst", heißt es in der Bildunterschrift.38 Diese Reaktion wurde zwar auf der Grundlage eines irrigen Glaubens durchgeführt, stellte aber dennoch einen Wendepunkt auf dem Weg zur modernen Chemie dar. Sie war wohl der erste Fall einer auf Kenntnissen basierenden Synthese einer neuen Substanz aus zwei bekannten Bestandteilen. Außerdem war sie die erste eindeutige Demonstration der Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen - Quecksilber verbindet sich nämlich nicht nur leicht mit Schwefel zu Quecksilbersulphid (Zinnober), sondern das Quecksilbersulphid zerfällt, wenn man es erhitzt, auch wieder in seine beiden Bestandteile. So lieferte sie einen bedeutenden Hinweis darauf, dass Materie weder erschaffen noch zerstört werden kann.
Das Experiment ist nicht schwierig. Ich könnte das Quecksilber aus einem alten Thermometer verwenden, es in einen Schmelztiegel tun, eine entsprechende Menge Schwefel hineinmischen, das Ganze abdecken und erhitzen, bis die satte zinnoberrote Farbe von Quecksilbersulphid hervorträte.
Ich könnte es nochmals erhitzen, um diese beiden konstituierenden Elemente wieder zu trennen, und dann das Quecksilber abdestillieren, während der Schwefel verbrennt. Nun halte ich zwar die groß herausgestellten Gefahren der vielen chemischen Experimente, von deren Durchführung zu Hause heutzutage dringend abgeraten wird, für übertrieben, doch heute ist mir klar, dass Quecksilberdampf ein höchst unangenehmes Zeug ist - was ich nicht wusste, als ich mein Quecksilber durch Erhitzen von Batterien gewann.
Ich gebe mich damit zufrieden, das Experiment mit Hilfe von Marcos Martinon-Torres am University College London aus einiger Entfernung zu beobachten. Marcos hat sich eine akademische Laufbahn an der Schnittstelle zwischen Archäologie und Materialwissenschaft erkämpft, die ihm einen wundervollen Vorwand liefert, die Experimente der Alchemisten im Interesse der historischen Genauigkeit nachzustellen. Doch als es darum ging, das Quecksilber-Schwefel-Experiment zu wiederholen, wurde selbst er aus den Laboratorien seines Instituts verbannt und genötigt, sich in ein geheim gehaltenes Feld irgendwo in den Vororten zu verziehen.
Das Reaktionsgefäß ist ein tönernes Aludel - ein arabisches Wort wie so viele in der Chemie -, eine Art Schmelztiegel mit einem hohen spitzen Deckel, ähnlich einem Hexenhut, wo sich Dämpfe vermischen und abkühlen können. Der Apparat hat ungefähr die Größe und Form eines Straußeneis. Ein kleines Luftloch oben verhindert, dass innerhalb des Geräts der Druck zunimmt und eine Explosion verursacht. Marcos und Nicolas Thomas, ein anderer Kollege von der Pariser Universität Pantheon-Sorbonne, besprengen den Zinnober, den sie unten in dem Gefäß eingebracht haben, setzen den Hut obendrauf und schließen das Ganze mit feuchtem Ton luftdicht ab. Dann bauen sie aus Ziegelsteinen und Ton einen kleinen Ofen, füllen diesen mit Holzkohle und stecken sie an. Wenn sie meinen, es sei heiß genug, um den Zinnober zu zersetzen, aber noch nicht so heiß, dass das Quecksilber als Dampf entweicht, stellen sie den Aludel in den Ofen. Mit Atemgeräten hocken sie sich daneben und beobachten aufmerksam den Aludel, der sich von der Gluthitze des Feuers allmählich erwärmt. Erleichtert darüber, dass er nicht explodiert ist, beobachten sie bald kleine Tröpfchen Quecksilber, die sich rings um das Entlüftungsloch niedergeschlagen haben. Daran erkennt man, dass die Reaktion stattgefunden hat. Nachdem das Gerät abgekühlt ist, öffnen sie es. Ein Sternenzelt winziger schimmernder Kügelchen hat sich an der Innenwand abgesetzt. Sie sammeln das Quecksilber ein, setzen Schwefel hinzu und erhitzen das Ganze erneut. Dabei erhalten sie wieder den Zinnober, ein Durcheinander von Gelb und Rot, teils fest, teils geschmolzen, das für jedermann wie ein gedämpfter Melassepudding aussieht, aber höllisch riecht.
zu Teil 2
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens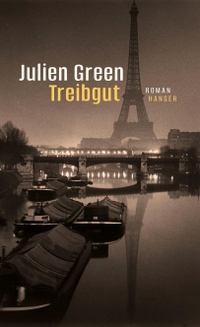 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut