José Leonardo
Er erschien immer samstags auf dem Markt, unter einem breitkrempigen Hut, aufrecht in einem Sattel mit ausgebeulten Taschen, in einem Gewirr von Quersäcken, Peitschen und Gepäck. Die würdevollste Erscheinung, die ich je sah. Ernst, vom reglosen Ernst einer Statue, helle, große, offen blickende Augen.
Soweit ich mich erinnere, machte José Leonardo alles zur rechten Zeit und stets ohne Eile: Er funktionierte wie eine Uhr, das Räderwerk lief gleichmäßig, die Zeiger deuteten auf eine bestimmte Anzahl von Aufgaben.
Die Händler und Kaufleute priesen ihn und stritten sich seinetwegen. Antônio Freire, sein Bruder, gab nicht viel auf Pflichten: Er lebte auf der Straße, bettelte sich zusammen, was er brauchte. Jedermann gab ihm. José Leonardo zahlte ohne lange zu verhandeln, tat, als sähe er nicht, was wirklich vor sich ging, und die Schankwirte erfanden Rechnungen, ließen ihn zur Ader.
Ich weiß nicht, wie es kam, dass dieser Mann auf mich zuging. Unsere Nachdenklichkeit und unsere Verschlossenheit hätten uns voneinander fernhalten müssen. Er brachte mir Geschenke, wir wurden Freunde, er nahm mich mit zum Pico, der Fazenda, die er zwei Wegmeilen von unserem Marktflecken entfernt besaß. Vom Sommer bis zum Winter zog sich das Brachland als grüner Streifen durch den Buschwald. In der Ferne erhob sich senkrecht ein Gebirge, eine seltsame steinerne Mauer, gekrönt von einem Gipfel, der aussah wie ein abgestorbener Baum. Daher Pico - Gipfel -, der Name des Landgutes. Ein Bach kam von dort, der weder anschwoll noch versiegte. Kanalisiert und gezähmt in einer hölzernen Traufe, mündete er in die Tränke, die unter einem Zedrachbaum vermoderte und sich als vorzüglicher Badetrog erwies. Ich erinnere mich noch an mein erstes Bad. Der kalte Strahl streifte uns wohlig in der Hitze. Seu Filipe Benício seifte sich ein und sah aus wie mit Zuckerguss überzogen. Er schüttelte sich, als wollte er seine Glieder von sich werfen. Tauchte in den vollen Trog, schnaubte und prustete wie ein Tier. Dann erhob er sich frisch und sauber aus dem Schaum. Sein langer Schnurrbart floss weiß dahin, das ebenfalls weiße Haar auf Brust und Bauch kringelte sich, überraschte mich. Wie konnte ein Mensch nur dermaßen behaart sein!
Das Wasser schwappte über den Rand des Trogs, floss frei durch die Pflanzungen und bewässerte das Zuckerrohr, riesige, für diese Gegend einzigartige Stauden. Jenseits des Feuchtgebiets erstreckte sich der Sertão, zunächst nur zögerlich, durchzogen von kümmerlichen Palmen und Caju-Bäumen, dann trocken und gelb, übersät von Kakteen, Skeletten und Steinen. Hier schleppten sich die verhungerten und abgerissenen Kreaturen dahin, die auf den Märkten Körbe mit Früchten des Imbuzeiro-Baumes und Kleinwild verkauften. In Notzeiten lebten sie davon, und da häufig Not herrschte, wanderten sie ab und endeten im Elend. Da und dort eine Hütte, Schuppen mit kränklichen Ziegen, trauriges Glockengebimmel.
Auf meinen Ausflügen zum Pico, auf der Kruppe von José Leonardos Pferd, gähnte ich in der Hitze, ließ meinen Blick
über die versengte Ebene schweifen und hielt Ausschau nach dem Blattwerk eines Juazeiro-Baumes. Plötzlich, unverwechselbar, Üppigkeit und Schatten, sie hatten dem bescheidenen Landbesitzer zu dieser inneren Ruhe verholfen. José Leonardo war tatsächlich unabhängig. Die Fazendeiros der Region unterwarfen sich einem Wechselspiel: Jahren der Fülle und Jahren der Not. Einmal brachte die Erde Überfluss hervor, ein andermal nicht das Geringste. Verschwendung und Geiz. Und jede Anstrengung war vergeblich.
José Leonardo kannte weder übermäßige Gewinne noch größere Verluste. Er widmete sich, anders als seine Nachbarn, einer sicheren Tätigkeit. Er züchtete kein Vieh - Pico war frei vom Morast und den Fliegen der Koppeln. Zu Hause und bei der Arbeit trug er Stoff, was ungewöhnlich war. Im Allgemeinen taten dies nur die Städter. Die Landbewohner kleideten sich in Leder und sahen aus wie Gürteltiere. Bis auf die kargen Pflanzungen im Schwemmland der Wehre und an den zerklüfteten Ufern der periodisch wasserführenden Flussläufe wurde in dieser Gegend nichts angebaut. Die Säcke mit Mais und Bohnen im Haus meines Großvaters kamen von weit, stammten aus dem fruchtbaren Küstenstreifen. Hier versahen die Männer die Tiere mit Brandzeichen, kastrierten, molken, zerlegten das Fleisch, gerbten, stellten Peitschen und Seile her; die Frauen füllten Töpfe mit Milch, bereiteten daraus Dickmilch und Käse.
In Pico nahm man weder den Geruch von Blut noch von Verwesung wahr, wie ihn die von Maden befallenen Wunden der Tiere verströmten. Und mir bisher unbekannte Tätigkeiten hielten mich vom ersten Augenblick an in Atem. Ich trieb mich stundenlang in der Zuckermühle herum, bestaunte die ins Joch gespannten, um eine Achse kreisenden Ochsen, das zwischen hölzernen Walzen zerquetschte Zuckerrohr, den Saft, der über eine Rinne in den ersten Kessel der Anlage floss. Sich von dort über an Stangen befestigte Kalebassen in die nächsten Kessel ergoss, um vom dritten Kessel aus als rote Melasse die Formen zu füllen, die auf dem von Trester bedeckten Boden eine Unmenge brauner Zuckerbarren hinterließen.
Mir war nie in den Sinn gekommen, dass Zuckerbarren ein Produkt menschlicher Arbeit sein könnten. In ihren Verpackungen, in den Gemischtwarenläden, sah man ihnen die vielen Arbeitsgänge nicht an. Für mich ein kurioser Zeitvertreib. Schön und goldfarben wurden sie noch warm aufeinandergeschichtet. Ich hätte für immer dort bleiben mögen, in der Wärme des Brennofens, und zusehen, wie das Zuckerrohr zermalmt wurde, die Flüssigkeit in den Kübeln brodelte, eindickte und sich verfestigte.
Abends, im Herrenhaus, wurde getanzt und gesungen. Das Mondlicht streifte die weißen Kiesel auf den Wegen. Einer schien mir stärker zu schimmern als die anderen und José Leonardo nötigte mich, ihn zu nehmen und zu behalten. Ich bewahrte diese kleine, im Dunkel funkelnde Kostbarkeit einige Jahre auf. In einer Nische der Wand, ließ sie diese Erinnerungen, wie ein Stück Glut in der Asche, in Stunden des Unmuts und des Schmerzes erneut aufflackern - das grüne Band der Zuckerrohrpflanzung, das das Schwemmland flutende Wasser, die zahmen, in der Zuckermühle kreisenden Ochsen, die in den Kesseln kochende Melasse, die Tänze und Lieder, die buntgefiederten Papageien. Und sie erhellte die sich unnahbar, würdevoll und still in der Vergangenheit verlierende Gestalt. Eine Freundlichkeit, anders als die übliche. Sie zog nicht an, flößte aber Vertrauen ein, siegte über die unselige Schüchternheit, die mir die Zunge lähmte, meinen Blick trübte, meine Hände eiskalt werden ließ.
Ich überhäufte José Leonardo mit Fragen, nie war er unwillig. Manchmal zögerte er, suchte in meinem Gesicht nach dem Sinn eines unklaren Satzes. Und die Antwort kam wie selbstverständlich und geduldig. Auch wenn er mich nicht über alle Maßen beeindruckte, meine Erinnerung an ihn ist von Dauer und verbunden mit wohlwollenden Gefühlen.
Ich zog fort in die Stadt. Der glitzernde Stein verschwand - und waren die Gebete gesagt und die Petroleumlampe gelöscht, versank mein Zimmer im Dunkel. Sein heiter-gelassenes Bild aber verließ mich nicht. Gesellte sich abends zu denen der Heiligen, verständnisvoll und großherzig, suchte weder mich zu verbessern, noch mir einen dieser Ratschläge zu erteilen, die mich nur quälten und nichts nutzten.
*
Meine natürliche Schwester
Wir waren mehrmals auf der Fazenda meines Großvaters gewesen. Dieses Mal, das entscheidende Mal, blieben wir drei Monate - und unsere Familie gewann ein Mitglied hinzu und verlor ein anderes.
Der Gewinn kam in Gestalt eines kleinen greinenden Jungen zu uns, der bald starb. Meine Mutter legte sich auf das Bett aus rohem Leder, und ich wurde für einige Stunden in den Buschwald am See geschickt. Als ich zurückkam, trug der Kleine Windeln, ein Amulett um den Arm, war mit Lavendel umräuchert, um böse Geister von ihm fernzuhalten, und unterzog sich Maria Melos Prophezeiungen. Alles ging erneut seinen geordneten Gang: Meine Mutter erholte sich, die Kapaune, die in dem kleinen Gehege neben dem Garten gemästet wurden, mussten ihr Leben lassen.
Das Mitglied unserer Familie, das verschwand, war Mocinha. Ob dem wirklich so war, weiß ich nicht, jedenfalls verließ sie uns. Vielleicht betrachtete man sie gar nicht als Verwandte: In welcher Beziehung sie zu uns stand, war unklar. Bevor mein Vater heiratete, war Mocinha über undurchsichtige Kanäle zu ihm geschickt und in die Obhut von Tante Dona gegeben worden, einer armen Witwe, die bei ihm lebte und Mutter zweier kleiner Töchter war. Dann heiratete er, und mit der Heirat kam die Veränderung, Tante und Cousinen wurden zurückgelassen, und Mocinha begleitete uns in den Sertão.
Ein gesundes Geschöpf mit weißer Haut, großen Augen und schwarzem Haar, so hübsch, dass ich an unserer Blutsverwandtschaft zweifelte. Es schien, als wolle man sie nicht zur Kenntnis nehmen. Man sperrte sie in eine kleine dunkle Kammer. Daran war nichts Besonderes: Wir hatten seit jeher feuchte, traurige, sicher verschlossene Kammern für die Frauen. Ihr Platz war am äußeren Ende des Tisches, sie betete und aß mit gesenktem Kopf. Sie musste diesen Zwang als Qual empfunden haben, denn im Garten hinter dem Haus, in der Küche, unter dem Vordach, lachte sie, sang und plauderte mit Rosenda, der Wäscherin. Auf dem Weg zum Wohnzimmer machte sie sich klein, zog sich in sich zurück, wurde zu einem Nichts.
Meine Mutter behandelte sie fast übertrieben förmlich. Bisweilen tat sie ihre Abneigung offen kund, murrte, schnalzte verächtlich - und wir schwachen Wesen, Kinder und Negerjungen, betrachteten besorgt diese nichts Gutes verheißenden Bekundungen. Doch sie konnten Mocinha nicht viel anhaben. Sie war wie eine Fremde, ein Dauergast, wenngleich sie sich die Zeit mit leichten Arbeiten vertrieb: Sie stickte Palmzweige und zarte Blumen auf weißen, in einen Rahmen gespannten Batist, besserte Hemden aus, stärkte weiße Röcke in Wäscheblau, plättete sie auf einem Brett, das mit einem Tuch bezogen war und auf zwei Stuhllehnen lag.
Damit war ihrem Tätigkeitsdrang Genüge getan. Ihre geistigen Bedürfnisse wurden mit Messen zufriedengestellt, mit Novenen, Rosenkränzen im Monat Mai, Unterhaltungen neben der Maniokpresse unter dem Vordach und dem Lesen eines langen Romans, der Geschichte von Adélia und Dom Rufo. In Wirklichkeit war Mocinha nahezu Analphabetin, aber die wieder und wieder gelesene Geschichte stellte kein Hindernis mehr für sie dar. Adélia und Dom Rufo erschlossen sich ihr wie von selbst. Die Tugenden Dom Boscos in den gelben Broschüren der Salesianer hingegen nur mit Mühe und unter Zweifeln.
Wenn Mocinha aufstand und sich in ihre finstere Kammer ohne Fenster zurückzog, ging sie zuvor zu meinem Vater und flüsterte ihm hastig etwas zu. Er spendete ihr brummend seinen
Segen und entfernte sich mürrisch.
Es war eine Pflicht, ein Brauch, der ihm schmeichelte und ihn zugleich herabminderte. Wahrscheinlich erlaubte ihm seine wirtschaftliche Lage (sich verringernder Viehbestand, billiges Tuch in den Regalen) nicht, Kinder in vielen Bäuchen zu zeugen und Profit aus ihrer Arbeit zu ziehen. Mittelmäßig wie er darin war, unterwarf sich der allgemeinen Moral - und sein im Morgengrauen und bei Einbruch der Nacht lau gespendeter Segen war nichts anderes als ein Eingeständnis, dass es ihm versagt war, viele Frauen zu schwängern und für eine zahlreiche Nachkommenschaft zu sorgen. Er zeugte und schwängerte, doch mit Bedacht und Methode. Er war ein reflektierter, listiger Patriarch und führte minutiös Buch über seine Liebesentgleisungen. Mocinha stellte keinerlei Nutzen dar. Ein Gefühlswert, sündigen Ursprungs. Und mein Vater versuchte, die anderen von ihrer Nicht-Existenz zu überzeugen.
Was nicht leicht war. Der ungebetene Gast gewann an Wuchs und Schönheit, änderte seine Kleidung, verliebte sich in den Wohnzimmerspiegel. Und vom Spiegel sprang Mocinha zum Fenster, wo ihr Miguel in der Abenddämmerung zärtliche Worte zuraunte.
Miguel, ein einflussreicher Mann, einer der einflussreichsten vor Ort, konnte nicht einfach eine Verbindung mit einem Naturkind eingehen. Seine Familie, der das Haus mit den Kacheln gehörte, das mich bei meiner Ankunft in der kleinen Stadt in solches Staunen versetzt hatte, protestierte. Mein Vater protestierte ebenfalls, ausgiebig und nicht ohne Stolz, er bildete sich etwas ein auf Miguels Wahl, doch zeigte er sich ebenso streng wie unnachgiebig. Die Fensterläden wurden verschlossen und überwacht, die Beziehungen zur Außenwelt erschwert; man versagte dem jungen, nunmehr als Mensch betrachteten Mädchen fortan die beiden täglichen Segnungen, bedachte sie mit Schimpfe und bitteren Vorwürfen.
Ich fragte mich später, aus welchen Gründen mein Vater einen jungen Mann aus gutem Hause, der zudem eine wichtige Rolle in der Lokalpolitik spielte, zurückgewiesen haben mochte. Vielleicht aus Angst, ins Gerede zu kommen. Vielleicht scheute er sich auch, Verantwortung zu übernehmen, Konsequenzen zu tragen. Es entsprach nicht seiner Art. Für gewöhnlich beschäftigte er sich mit eher unwichtigen Dingen, spielte stundenlang Karten, sein winterlicher Zeitvertreib, füllte eine Untertasse mit Spielmarken und ging nur ein Risiko ein, wenn er sämtliche Trümpfe in der Hand hielt. Er misstraute Erfolgen ebenso wie raschen und leichten Gewinnen, die Einsatz und Mut erforderten - und war nach dem Schiffbruch, den er mit seiner Fazenda erlitten hatte (verhungertes Vieh, Räude, Vernichtung), übertrieben vorsichtig geworden. In Wirklichkeit war er ehrgeizig, doch war sein Ehrgeiz nicht von Dauer. Abenteuer und Risiken reizten ihn - sofern sie sich in Grenzen hielten - dahingehend, dass er seinen Kunden Kredit einräumte. Er unterzog sie unter Anwendung sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen einer eingehenden Prüfung, verdoppelte den Preis der Ware, fiel die Rechnung jedoch ein wenig höher aus, schwitzte er Blut und Wasser. Nach Ablauf einer neunzigtägigen Frist knöpfte er seinen Schuldnern monatlich zwei Prozent Zinsen ab.
Möglicherweise ließ er sich auch in Mocinhas Liebesangelegenheit entsprechend seinem üblichen Geschäftsgebaren von wirtschaftlichen Gesichtspunkten lenken. Hätte er Miguels guten Absichten Rechnung getragen, hätte er eine Aussteuer in Auftrag geben, Koffer kaufen, ein Fest mit öffentlichem Aufgebot bestellen, eine kirchliche Trauung, Musik und ein Essen für Dutzende Gäste ausrichten müssen. Pater João Inácio wäre gekommen, Komtur Badega, Seu Félix Cursino, Teotoninho Sabiá und Filipe Benício. Man hätte Reden halten müssen und tanzen. Dies alles machte nicht nur Arbeit, sondern war auch mit Kosten verbunden und widersprach der Natur meines Vaters. Es hätte sein Leben in Unordnung gebracht. Unser Esstisch war klein, von harten Bänken umgeben. Mit den Jahren wurde er größer, bewirtete zahlreiche Gäste, damals aber nahmen für gewöhnlich sechs bis acht Personen an ihm Platz. Und im Wohnzimmer konnten sich, selbst wenn man Sofa und Stühle entfernt hatte, nur wenige Paare einigermaßen frei bewegen. Mein Vater hasste das Tanzen, und doch gehörte es unweigerlich zu jeder Hochzeit. Wahrscheinlich erinnerte es ihn an bei Walzern und Quadrillen begangene Sünden - daher der Abscheu. In seinem Leben, im Dunkel seiner Vergangenheit, gab es eine Deolinda, auf die meine Mutter immer wieder eifersüchtig anspielte. Deolinda war unerhörterweise zum Walzer und zur Quadrille erschienen und hatte ihren Ehemann betrogen - weshalb mein Vater diese verwerfliche Kür vehement ablehnte. Meine Mutter vergaß ihre Missbilligung und beging einen Fehler: Sie tanzte im Haus meines Großvaters mit einem bärtigen Cousin. Sie bereute, zog mich an ihre magere Brust und flehte mich an, niemandem von ihrem unseligen Ausrutscher zu erzählen. Ich gab ihr mein Wort. Als wir uns später stritten, drohte ich ihr. Sie ignorierte meine Drohungen, zog mich an den Ohren. Ich durchschaute ihr perfides Verhalten, war aber großmütig, gab nichts preis. Und das gute Einvernehmen des Paares wurde nicht getrübt.
Deolinda hatte sich in Rauch aufgelöst. Und Mocinha stickte ungerührt weiter ihre Palmblätter und Blumen, stärkte Röcke und hörte Messen. Sie hatte in ihrem langen, zerfledderten Roman Bekanntschaft mit Dom Rufo und Adélia geschlossen. Und Miguel zu einem tugendhaften jugendlichen Helden verklärt. Unser totalitäres Regime ließ einen Dom Rufo und eine Adélia zu, aber keinen Miguel. Es unternahm keinen Versuch, die Fiktion zwischen den abgegriffenen Buchdeckeln zu unterdrücken. Lesen war erlaubt, zumal es nichts brachte, politische Artikel und Geschäftsbücher ausgenommen. Das Regime räumte Mocinha zwar das Recht auf Romanhelden ein, wachte aber über dessen Jungfräulichkeit. Es fühlte sich verpflichtet, das Mädchen über lange Jahre zu ernähren, mit Kleidung und Schuhwerk zu versehen. Ausgaben, so gering, dass sie sich kaum bemerkbar machten. Wohingegen es für Bettlaken, Kopfkissenbezüge, Hemden, ein weißes Kleid, Schleier, Brautkranz, Bänder und Spitzen, reichlich Essen und Trinken, Musik und dergleichen tief in die Tasche hätte greifen müssen. Tante Dona hatte kein Glück gehabt in ihrer Ehe, verwitwet und tuberkulosekrank stand sie allein mit zwei Töchtern da. Tante Josefa war unbemannt geblieben und alterte in der Ferne. Tante Jovina alterte ebenfalls und tut dies noch immer, hinkend und traurig in Gesellschaft der letzten meiner natürlichen Schwestern. Mein Vater verteilte Brosamen an diese armen Geschöpfe. Er wollte weiterhin für Mocinhas Unterhalt aufkommen, sofern sie sich sittsam verhielt und still vor sich hin lebte, im Käfig und in der Moral.
Doch sie hatte das feurige Blut ihrer Mutter und litt unter der Einsamkeit. Zudem wollte Miguel keine Romanfigur sein. Sie verstanden einander, trotz des Verbots, entflammten füreinander, tauschten Zeichen aus und Briefchen. Und die Sache war entschieden.
Die Sippschaft meines Großvaters versammelte sich im Wohnraum um den Tisch, in dessen Schubladen sich Wachskugeln befanden und hölzerne Hämmer, mit denen man Rinder kastrierte, und darüber, in himmlischer Herrlichkeit, bunte Bilder und Statuen, Jesus, die Jungfrau Maria und Heilige beiderlei Geschlechts. Meine Mutter wiegte ihr Neugeborenes in der Hängematte, neben dem Bett aus Rohleder, im langsam verlöschenden Licht der Nachtlampe. Maria Melo sagte ihre Litanei auf. Der Hausherr, Ciríaco, der alte Ziegenhirt, sowie eine Handvoll Günstlinge beteten auf ihre Lederhüte gekniet. Die Hausherrin, Mädchen aus der Nachbarschaft und die Negerinnen
aus der Küche waren auf die Strohmatten gesunken, schlugen sich gegen die Brust und sangen. Meine schmerzenden, vereiterten Augen waren unter einem schwarzen Tuch verborgen, tränten, nahmen nur mühsam verschwommene Gestalten wahr und flackernde Kerzenflammen. Die Außenwelt drang diffus und bruchstückhaft an mein Ohr. Das Quietschen der Hängemattenhaken verstummte, die Stimmen wurden schwächer, die Litanei erstarb, die Frauen erhoben sich mit zerknittertem Röckerascheln, Binsenschuhe und Pantoffeln schlurften über den Fußboden, der Glanz des Hausaltars verblasste, die unverputzten Wände wurden noch dunkler.
Plötzlich Aufregung: Mocinha war verschwunden. Sie suchten überall nach ihr: Das Licht der Kerosinlampen erhellte die Schlafkammern, den Baumwollspeicher, den Garten hinter dem Haus, den nahen Buschwald, den Innenhof; die Rufe meines Großvaters hallten an den Steilufern des Ipanema wider. Von Mocinha keine Spur. Reiter hatten sie, eine gewaltsame Entführung vortäuschend, mitgenommen und dem damaligen Brauch entsprechend der Obhut alter Frauen übergeben, die über sie wachten. In diesem Asyl konnte ihr nichts Böses geschehen, doch eines stand fest: Ein geflohenes Mädchen war ein gefallenes Mädchen.
Um diesen absurden Schaden zu beheben, handelten wortgewandte Vermittler ein Treffen zwischen beiden Familien aus. Man führte die üblichen Gespräche, ohne jedoch zu einer Übereinstimmung zu kommen. Mein Vater blieb unnachgiebig und stolz. Bei seiner Rückkehr war er unrasiert und beteuerte, die Undankbare bedeute für ihn so viel wie eine abgeschnittene Hand. Ein seltsamer Satz. Tatsächlich hatte ihm die Kleine nie als Hand gedient. Aber so war mein Vater: Er liebte emphatische Ausdrücke und hielt sich nicht lange mit dem Sinn der Worte auf. Eine abgeschnittene Hand! Diese Amputation ersparte ihm Heiratsaufgebote, Schleier, Brautkranz, Spitzen, Bänder, Bettwäsche und ein Hochzeitsmahl. Mocinha heiratete in aller Stille, ohne Musik und ohne Tanz, während der Sieben-Uhr-Messe. Sie verbrachte einige wenige Jahre in Glück und Harmonie.
Sie versuchte, sich mit uns auszusöhnen. Als mein Vater im Laden Karten spielte, kam sie durch das Gartentor, blieb eine Stunde und unterhielt sich leise mit meiner Mutter neben der Maniokpresse unter dem Vordach.
Dann zogen wir um, und wir verloren den Kontakt. Miguel verließ sie, tat sich mit einer anderen zusammen, auf dem Standesamt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er auch noch eine Indianerin geheiratet, irgendwo im Amazonas nach indianischem Recht. Mocinha verschwand und hinterließ keine Spur.
*
Auszüge mit freundlicher Genehmigung des Wagenbach Verlages (Copyright Verlag Klaus Wagenbach)
Mehr Informationen zum Buch und zum Autor hier
Er erschien immer samstags auf dem Markt, unter einem breitkrempigen Hut, aufrecht in einem Sattel mit ausgebeulten Taschen, in einem Gewirr von Quersäcken, Peitschen und Gepäck. Die würdevollste Erscheinung, die ich je sah. Ernst, vom reglosen Ernst einer Statue, helle, große, offen blickende Augen.
Soweit ich mich erinnere, machte José Leonardo alles zur rechten Zeit und stets ohne Eile: Er funktionierte wie eine Uhr, das Räderwerk lief gleichmäßig, die Zeiger deuteten auf eine bestimmte Anzahl von Aufgaben.
Die Händler und Kaufleute priesen ihn und stritten sich seinetwegen. Antônio Freire, sein Bruder, gab nicht viel auf Pflichten: Er lebte auf der Straße, bettelte sich zusammen, was er brauchte. Jedermann gab ihm. José Leonardo zahlte ohne lange zu verhandeln, tat, als sähe er nicht, was wirklich vor sich ging, und die Schankwirte erfanden Rechnungen, ließen ihn zur Ader.
Ich weiß nicht, wie es kam, dass dieser Mann auf mich zuging. Unsere Nachdenklichkeit und unsere Verschlossenheit hätten uns voneinander fernhalten müssen. Er brachte mir Geschenke, wir wurden Freunde, er nahm mich mit zum Pico, der Fazenda, die er zwei Wegmeilen von unserem Marktflecken entfernt besaß. Vom Sommer bis zum Winter zog sich das Brachland als grüner Streifen durch den Buschwald. In der Ferne erhob sich senkrecht ein Gebirge, eine seltsame steinerne Mauer, gekrönt von einem Gipfel, der aussah wie ein abgestorbener Baum. Daher Pico - Gipfel -, der Name des Landgutes. Ein Bach kam von dort, der weder anschwoll noch versiegte. Kanalisiert und gezähmt in einer hölzernen Traufe, mündete er in die Tränke, die unter einem Zedrachbaum vermoderte und sich als vorzüglicher Badetrog erwies. Ich erinnere mich noch an mein erstes Bad. Der kalte Strahl streifte uns wohlig in der Hitze. Seu Filipe Benício seifte sich ein und sah aus wie mit Zuckerguss überzogen. Er schüttelte sich, als wollte er seine Glieder von sich werfen. Tauchte in den vollen Trog, schnaubte und prustete wie ein Tier. Dann erhob er sich frisch und sauber aus dem Schaum. Sein langer Schnurrbart floss weiß dahin, das ebenfalls weiße Haar auf Brust und Bauch kringelte sich, überraschte mich. Wie konnte ein Mensch nur dermaßen behaart sein!
Das Wasser schwappte über den Rand des Trogs, floss frei durch die Pflanzungen und bewässerte das Zuckerrohr, riesige, für diese Gegend einzigartige Stauden. Jenseits des Feuchtgebiets erstreckte sich der Sertão, zunächst nur zögerlich, durchzogen von kümmerlichen Palmen und Caju-Bäumen, dann trocken und gelb, übersät von Kakteen, Skeletten und Steinen. Hier schleppten sich die verhungerten und abgerissenen Kreaturen dahin, die auf den Märkten Körbe mit Früchten des Imbuzeiro-Baumes und Kleinwild verkauften. In Notzeiten lebten sie davon, und da häufig Not herrschte, wanderten sie ab und endeten im Elend. Da und dort eine Hütte, Schuppen mit kränklichen Ziegen, trauriges Glockengebimmel.
Auf meinen Ausflügen zum Pico, auf der Kruppe von José Leonardos Pferd, gähnte ich in der Hitze, ließ meinen Blick
über die versengte Ebene schweifen und hielt Ausschau nach dem Blattwerk eines Juazeiro-Baumes. Plötzlich, unverwechselbar, Üppigkeit und Schatten, sie hatten dem bescheidenen Landbesitzer zu dieser inneren Ruhe verholfen. José Leonardo war tatsächlich unabhängig. Die Fazendeiros der Region unterwarfen sich einem Wechselspiel: Jahren der Fülle und Jahren der Not. Einmal brachte die Erde Überfluss hervor, ein andermal nicht das Geringste. Verschwendung und Geiz. Und jede Anstrengung war vergeblich.
José Leonardo kannte weder übermäßige Gewinne noch größere Verluste. Er widmete sich, anders als seine Nachbarn, einer sicheren Tätigkeit. Er züchtete kein Vieh - Pico war frei vom Morast und den Fliegen der Koppeln. Zu Hause und bei der Arbeit trug er Stoff, was ungewöhnlich war. Im Allgemeinen taten dies nur die Städter. Die Landbewohner kleideten sich in Leder und sahen aus wie Gürteltiere. Bis auf die kargen Pflanzungen im Schwemmland der Wehre und an den zerklüfteten Ufern der periodisch wasserführenden Flussläufe wurde in dieser Gegend nichts angebaut. Die Säcke mit Mais und Bohnen im Haus meines Großvaters kamen von weit, stammten aus dem fruchtbaren Küstenstreifen. Hier versahen die Männer die Tiere mit Brandzeichen, kastrierten, molken, zerlegten das Fleisch, gerbten, stellten Peitschen und Seile her; die Frauen füllten Töpfe mit Milch, bereiteten daraus Dickmilch und Käse.
In Pico nahm man weder den Geruch von Blut noch von Verwesung wahr, wie ihn die von Maden befallenen Wunden der Tiere verströmten. Und mir bisher unbekannte Tätigkeiten hielten mich vom ersten Augenblick an in Atem. Ich trieb mich stundenlang in der Zuckermühle herum, bestaunte die ins Joch gespannten, um eine Achse kreisenden Ochsen, das zwischen hölzernen Walzen zerquetschte Zuckerrohr, den Saft, der über eine Rinne in den ersten Kessel der Anlage floss. Sich von dort über an Stangen befestigte Kalebassen in die nächsten Kessel ergoss, um vom dritten Kessel aus als rote Melasse die Formen zu füllen, die auf dem von Trester bedeckten Boden eine Unmenge brauner Zuckerbarren hinterließen.
Mir war nie in den Sinn gekommen, dass Zuckerbarren ein Produkt menschlicher Arbeit sein könnten. In ihren Verpackungen, in den Gemischtwarenläden, sah man ihnen die vielen Arbeitsgänge nicht an. Für mich ein kurioser Zeitvertreib. Schön und goldfarben wurden sie noch warm aufeinandergeschichtet. Ich hätte für immer dort bleiben mögen, in der Wärme des Brennofens, und zusehen, wie das Zuckerrohr zermalmt wurde, die Flüssigkeit in den Kübeln brodelte, eindickte und sich verfestigte.
Abends, im Herrenhaus, wurde getanzt und gesungen. Das Mondlicht streifte die weißen Kiesel auf den Wegen. Einer schien mir stärker zu schimmern als die anderen und José Leonardo nötigte mich, ihn zu nehmen und zu behalten. Ich bewahrte diese kleine, im Dunkel funkelnde Kostbarkeit einige Jahre auf. In einer Nische der Wand, ließ sie diese Erinnerungen, wie ein Stück Glut in der Asche, in Stunden des Unmuts und des Schmerzes erneut aufflackern - das grüne Band der Zuckerrohrpflanzung, das das Schwemmland flutende Wasser, die zahmen, in der Zuckermühle kreisenden Ochsen, die in den Kesseln kochende Melasse, die Tänze und Lieder, die buntgefiederten Papageien. Und sie erhellte die sich unnahbar, würdevoll und still in der Vergangenheit verlierende Gestalt. Eine Freundlichkeit, anders als die übliche. Sie zog nicht an, flößte aber Vertrauen ein, siegte über die unselige Schüchternheit, die mir die Zunge lähmte, meinen Blick trübte, meine Hände eiskalt werden ließ.
Ich überhäufte José Leonardo mit Fragen, nie war er unwillig. Manchmal zögerte er, suchte in meinem Gesicht nach dem Sinn eines unklaren Satzes. Und die Antwort kam wie selbstverständlich und geduldig. Auch wenn er mich nicht über alle Maßen beeindruckte, meine Erinnerung an ihn ist von Dauer und verbunden mit wohlwollenden Gefühlen.
Ich zog fort in die Stadt. Der glitzernde Stein verschwand - und waren die Gebete gesagt und die Petroleumlampe gelöscht, versank mein Zimmer im Dunkel. Sein heiter-gelassenes Bild aber verließ mich nicht. Gesellte sich abends zu denen der Heiligen, verständnisvoll und großherzig, suchte weder mich zu verbessern, noch mir einen dieser Ratschläge zu erteilen, die mich nur quälten und nichts nutzten.
*
Meine natürliche Schwester
Wir waren mehrmals auf der Fazenda meines Großvaters gewesen. Dieses Mal, das entscheidende Mal, blieben wir drei Monate - und unsere Familie gewann ein Mitglied hinzu und verlor ein anderes.
Der Gewinn kam in Gestalt eines kleinen greinenden Jungen zu uns, der bald starb. Meine Mutter legte sich auf das Bett aus rohem Leder, und ich wurde für einige Stunden in den Buschwald am See geschickt. Als ich zurückkam, trug der Kleine Windeln, ein Amulett um den Arm, war mit Lavendel umräuchert, um böse Geister von ihm fernzuhalten, und unterzog sich Maria Melos Prophezeiungen. Alles ging erneut seinen geordneten Gang: Meine Mutter erholte sich, die Kapaune, die in dem kleinen Gehege neben dem Garten gemästet wurden, mussten ihr Leben lassen.
Das Mitglied unserer Familie, das verschwand, war Mocinha. Ob dem wirklich so war, weiß ich nicht, jedenfalls verließ sie uns. Vielleicht betrachtete man sie gar nicht als Verwandte: In welcher Beziehung sie zu uns stand, war unklar. Bevor mein Vater heiratete, war Mocinha über undurchsichtige Kanäle zu ihm geschickt und in die Obhut von Tante Dona gegeben worden, einer armen Witwe, die bei ihm lebte und Mutter zweier kleiner Töchter war. Dann heiratete er, und mit der Heirat kam die Veränderung, Tante und Cousinen wurden zurückgelassen, und Mocinha begleitete uns in den Sertão.
Ein gesundes Geschöpf mit weißer Haut, großen Augen und schwarzem Haar, so hübsch, dass ich an unserer Blutsverwandtschaft zweifelte. Es schien, als wolle man sie nicht zur Kenntnis nehmen. Man sperrte sie in eine kleine dunkle Kammer. Daran war nichts Besonderes: Wir hatten seit jeher feuchte, traurige, sicher verschlossene Kammern für die Frauen. Ihr Platz war am äußeren Ende des Tisches, sie betete und aß mit gesenktem Kopf. Sie musste diesen Zwang als Qual empfunden haben, denn im Garten hinter dem Haus, in der Küche, unter dem Vordach, lachte sie, sang und plauderte mit Rosenda, der Wäscherin. Auf dem Weg zum Wohnzimmer machte sie sich klein, zog sich in sich zurück, wurde zu einem Nichts.
Meine Mutter behandelte sie fast übertrieben förmlich. Bisweilen tat sie ihre Abneigung offen kund, murrte, schnalzte verächtlich - und wir schwachen Wesen, Kinder und Negerjungen, betrachteten besorgt diese nichts Gutes verheißenden Bekundungen. Doch sie konnten Mocinha nicht viel anhaben. Sie war wie eine Fremde, ein Dauergast, wenngleich sie sich die Zeit mit leichten Arbeiten vertrieb: Sie stickte Palmzweige und zarte Blumen auf weißen, in einen Rahmen gespannten Batist, besserte Hemden aus, stärkte weiße Röcke in Wäscheblau, plättete sie auf einem Brett, das mit einem Tuch bezogen war und auf zwei Stuhllehnen lag.
Damit war ihrem Tätigkeitsdrang Genüge getan. Ihre geistigen Bedürfnisse wurden mit Messen zufriedengestellt, mit Novenen, Rosenkränzen im Monat Mai, Unterhaltungen neben der Maniokpresse unter dem Vordach und dem Lesen eines langen Romans, der Geschichte von Adélia und Dom Rufo. In Wirklichkeit war Mocinha nahezu Analphabetin, aber die wieder und wieder gelesene Geschichte stellte kein Hindernis mehr für sie dar. Adélia und Dom Rufo erschlossen sich ihr wie von selbst. Die Tugenden Dom Boscos in den gelben Broschüren der Salesianer hingegen nur mit Mühe und unter Zweifeln.
Wenn Mocinha aufstand und sich in ihre finstere Kammer ohne Fenster zurückzog, ging sie zuvor zu meinem Vater und flüsterte ihm hastig etwas zu. Er spendete ihr brummend seinen
Segen und entfernte sich mürrisch.
Es war eine Pflicht, ein Brauch, der ihm schmeichelte und ihn zugleich herabminderte. Wahrscheinlich erlaubte ihm seine wirtschaftliche Lage (sich verringernder Viehbestand, billiges Tuch in den Regalen) nicht, Kinder in vielen Bäuchen zu zeugen und Profit aus ihrer Arbeit zu ziehen. Mittelmäßig wie er darin war, unterwarf sich der allgemeinen Moral - und sein im Morgengrauen und bei Einbruch der Nacht lau gespendeter Segen war nichts anderes als ein Eingeständnis, dass es ihm versagt war, viele Frauen zu schwängern und für eine zahlreiche Nachkommenschaft zu sorgen. Er zeugte und schwängerte, doch mit Bedacht und Methode. Er war ein reflektierter, listiger Patriarch und führte minutiös Buch über seine Liebesentgleisungen. Mocinha stellte keinerlei Nutzen dar. Ein Gefühlswert, sündigen Ursprungs. Und mein Vater versuchte, die anderen von ihrer Nicht-Existenz zu überzeugen.
Was nicht leicht war. Der ungebetene Gast gewann an Wuchs und Schönheit, änderte seine Kleidung, verliebte sich in den Wohnzimmerspiegel. Und vom Spiegel sprang Mocinha zum Fenster, wo ihr Miguel in der Abenddämmerung zärtliche Worte zuraunte.
Miguel, ein einflussreicher Mann, einer der einflussreichsten vor Ort, konnte nicht einfach eine Verbindung mit einem Naturkind eingehen. Seine Familie, der das Haus mit den Kacheln gehörte, das mich bei meiner Ankunft in der kleinen Stadt in solches Staunen versetzt hatte, protestierte. Mein Vater protestierte ebenfalls, ausgiebig und nicht ohne Stolz, er bildete sich etwas ein auf Miguels Wahl, doch zeigte er sich ebenso streng wie unnachgiebig. Die Fensterläden wurden verschlossen und überwacht, die Beziehungen zur Außenwelt erschwert; man versagte dem jungen, nunmehr als Mensch betrachteten Mädchen fortan die beiden täglichen Segnungen, bedachte sie mit Schimpfe und bitteren Vorwürfen.
Ich fragte mich später, aus welchen Gründen mein Vater einen jungen Mann aus gutem Hause, der zudem eine wichtige Rolle in der Lokalpolitik spielte, zurückgewiesen haben mochte. Vielleicht aus Angst, ins Gerede zu kommen. Vielleicht scheute er sich auch, Verantwortung zu übernehmen, Konsequenzen zu tragen. Es entsprach nicht seiner Art. Für gewöhnlich beschäftigte er sich mit eher unwichtigen Dingen, spielte stundenlang Karten, sein winterlicher Zeitvertreib, füllte eine Untertasse mit Spielmarken und ging nur ein Risiko ein, wenn er sämtliche Trümpfe in der Hand hielt. Er misstraute Erfolgen ebenso wie raschen und leichten Gewinnen, die Einsatz und Mut erforderten - und war nach dem Schiffbruch, den er mit seiner Fazenda erlitten hatte (verhungertes Vieh, Räude, Vernichtung), übertrieben vorsichtig geworden. In Wirklichkeit war er ehrgeizig, doch war sein Ehrgeiz nicht von Dauer. Abenteuer und Risiken reizten ihn - sofern sie sich in Grenzen hielten - dahingehend, dass er seinen Kunden Kredit einräumte. Er unterzog sie unter Anwendung sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen einer eingehenden Prüfung, verdoppelte den Preis der Ware, fiel die Rechnung jedoch ein wenig höher aus, schwitzte er Blut und Wasser. Nach Ablauf einer neunzigtägigen Frist knöpfte er seinen Schuldnern monatlich zwei Prozent Zinsen ab.
Möglicherweise ließ er sich auch in Mocinhas Liebesangelegenheit entsprechend seinem üblichen Geschäftsgebaren von wirtschaftlichen Gesichtspunkten lenken. Hätte er Miguels guten Absichten Rechnung getragen, hätte er eine Aussteuer in Auftrag geben, Koffer kaufen, ein Fest mit öffentlichem Aufgebot bestellen, eine kirchliche Trauung, Musik und ein Essen für Dutzende Gäste ausrichten müssen. Pater João Inácio wäre gekommen, Komtur Badega, Seu Félix Cursino, Teotoninho Sabiá und Filipe Benício. Man hätte Reden halten müssen und tanzen. Dies alles machte nicht nur Arbeit, sondern war auch mit Kosten verbunden und widersprach der Natur meines Vaters. Es hätte sein Leben in Unordnung gebracht. Unser Esstisch war klein, von harten Bänken umgeben. Mit den Jahren wurde er größer, bewirtete zahlreiche Gäste, damals aber nahmen für gewöhnlich sechs bis acht Personen an ihm Platz. Und im Wohnzimmer konnten sich, selbst wenn man Sofa und Stühle entfernt hatte, nur wenige Paare einigermaßen frei bewegen. Mein Vater hasste das Tanzen, und doch gehörte es unweigerlich zu jeder Hochzeit. Wahrscheinlich erinnerte es ihn an bei Walzern und Quadrillen begangene Sünden - daher der Abscheu. In seinem Leben, im Dunkel seiner Vergangenheit, gab es eine Deolinda, auf die meine Mutter immer wieder eifersüchtig anspielte. Deolinda war unerhörterweise zum Walzer und zur Quadrille erschienen und hatte ihren Ehemann betrogen - weshalb mein Vater diese verwerfliche Kür vehement ablehnte. Meine Mutter vergaß ihre Missbilligung und beging einen Fehler: Sie tanzte im Haus meines Großvaters mit einem bärtigen Cousin. Sie bereute, zog mich an ihre magere Brust und flehte mich an, niemandem von ihrem unseligen Ausrutscher zu erzählen. Ich gab ihr mein Wort. Als wir uns später stritten, drohte ich ihr. Sie ignorierte meine Drohungen, zog mich an den Ohren. Ich durchschaute ihr perfides Verhalten, war aber großmütig, gab nichts preis. Und das gute Einvernehmen des Paares wurde nicht getrübt.
Deolinda hatte sich in Rauch aufgelöst. Und Mocinha stickte ungerührt weiter ihre Palmblätter und Blumen, stärkte Röcke und hörte Messen. Sie hatte in ihrem langen, zerfledderten Roman Bekanntschaft mit Dom Rufo und Adélia geschlossen. Und Miguel zu einem tugendhaften jugendlichen Helden verklärt. Unser totalitäres Regime ließ einen Dom Rufo und eine Adélia zu, aber keinen Miguel. Es unternahm keinen Versuch, die Fiktion zwischen den abgegriffenen Buchdeckeln zu unterdrücken. Lesen war erlaubt, zumal es nichts brachte, politische Artikel und Geschäftsbücher ausgenommen. Das Regime räumte Mocinha zwar das Recht auf Romanhelden ein, wachte aber über dessen Jungfräulichkeit. Es fühlte sich verpflichtet, das Mädchen über lange Jahre zu ernähren, mit Kleidung und Schuhwerk zu versehen. Ausgaben, so gering, dass sie sich kaum bemerkbar machten. Wohingegen es für Bettlaken, Kopfkissenbezüge, Hemden, ein weißes Kleid, Schleier, Brautkranz, Bänder und Spitzen, reichlich Essen und Trinken, Musik und dergleichen tief in die Tasche hätte greifen müssen. Tante Dona hatte kein Glück gehabt in ihrer Ehe, verwitwet und tuberkulosekrank stand sie allein mit zwei Töchtern da. Tante Josefa war unbemannt geblieben und alterte in der Ferne. Tante Jovina alterte ebenfalls und tut dies noch immer, hinkend und traurig in Gesellschaft der letzten meiner natürlichen Schwestern. Mein Vater verteilte Brosamen an diese armen Geschöpfe. Er wollte weiterhin für Mocinhas Unterhalt aufkommen, sofern sie sich sittsam verhielt und still vor sich hin lebte, im Käfig und in der Moral.
Doch sie hatte das feurige Blut ihrer Mutter und litt unter der Einsamkeit. Zudem wollte Miguel keine Romanfigur sein. Sie verstanden einander, trotz des Verbots, entflammten füreinander, tauschten Zeichen aus und Briefchen. Und die Sache war entschieden.
Die Sippschaft meines Großvaters versammelte sich im Wohnraum um den Tisch, in dessen Schubladen sich Wachskugeln befanden und hölzerne Hämmer, mit denen man Rinder kastrierte, und darüber, in himmlischer Herrlichkeit, bunte Bilder und Statuen, Jesus, die Jungfrau Maria und Heilige beiderlei Geschlechts. Meine Mutter wiegte ihr Neugeborenes in der Hängematte, neben dem Bett aus Rohleder, im langsam verlöschenden Licht der Nachtlampe. Maria Melo sagte ihre Litanei auf. Der Hausherr, Ciríaco, der alte Ziegenhirt, sowie eine Handvoll Günstlinge beteten auf ihre Lederhüte gekniet. Die Hausherrin, Mädchen aus der Nachbarschaft und die Negerinnen
aus der Küche waren auf die Strohmatten gesunken, schlugen sich gegen die Brust und sangen. Meine schmerzenden, vereiterten Augen waren unter einem schwarzen Tuch verborgen, tränten, nahmen nur mühsam verschwommene Gestalten wahr und flackernde Kerzenflammen. Die Außenwelt drang diffus und bruchstückhaft an mein Ohr. Das Quietschen der Hängemattenhaken verstummte, die Stimmen wurden schwächer, die Litanei erstarb, die Frauen erhoben sich mit zerknittertem Röckerascheln, Binsenschuhe und Pantoffeln schlurften über den Fußboden, der Glanz des Hausaltars verblasste, die unverputzten Wände wurden noch dunkler.
Plötzlich Aufregung: Mocinha war verschwunden. Sie suchten überall nach ihr: Das Licht der Kerosinlampen erhellte die Schlafkammern, den Baumwollspeicher, den Garten hinter dem Haus, den nahen Buschwald, den Innenhof; die Rufe meines Großvaters hallten an den Steilufern des Ipanema wider. Von Mocinha keine Spur. Reiter hatten sie, eine gewaltsame Entführung vortäuschend, mitgenommen und dem damaligen Brauch entsprechend der Obhut alter Frauen übergeben, die über sie wachten. In diesem Asyl konnte ihr nichts Böses geschehen, doch eines stand fest: Ein geflohenes Mädchen war ein gefallenes Mädchen.
Um diesen absurden Schaden zu beheben, handelten wortgewandte Vermittler ein Treffen zwischen beiden Familien aus. Man führte die üblichen Gespräche, ohne jedoch zu einer Übereinstimmung zu kommen. Mein Vater blieb unnachgiebig und stolz. Bei seiner Rückkehr war er unrasiert und beteuerte, die Undankbare bedeute für ihn so viel wie eine abgeschnittene Hand. Ein seltsamer Satz. Tatsächlich hatte ihm die Kleine nie als Hand gedient. Aber so war mein Vater: Er liebte emphatische Ausdrücke und hielt sich nicht lange mit dem Sinn der Worte auf. Eine abgeschnittene Hand! Diese Amputation ersparte ihm Heiratsaufgebote, Schleier, Brautkranz, Spitzen, Bänder, Bettwäsche und ein Hochzeitsmahl. Mocinha heiratete in aller Stille, ohne Musik und ohne Tanz, während der Sieben-Uhr-Messe. Sie verbrachte einige wenige Jahre in Glück und Harmonie.
Sie versuchte, sich mit uns auszusöhnen. Als mein Vater im Laden Karten spielte, kam sie durch das Gartentor, blieb eine Stunde und unterhielt sich leise mit meiner Mutter neben der Maniokpresse unter dem Vordach.
Dann zogen wir um, und wir verloren den Kontakt. Miguel verließ sie, tat sich mit einer anderen zusammen, auf dem Standesamt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er auch noch eine Indianerin geheiratet, irgendwo im Amazonas nach indianischem Recht. Mocinha verschwand und hinterließ keine Spur.
*
Auszüge mit freundlicher Genehmigung des Wagenbach Verlages (Copyright Verlag Klaus Wagenbach)
Mehr Informationen zum Buch und zum Autor hier
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens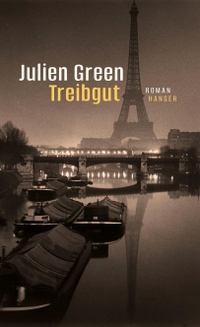 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut