(Seite 48 ff)
Die Rache des kleinen Mannes
Er schafft es nicht, "stem cells", Stammzellen, zu sagen, ohne sich zu versprechen. Er stolpert über Zahlen und Abkürzungen, angefangen bei der National Urban League, einer Organisation von Schwarzen zur Verteidigung der Bürgerrechte, bei der er zu Gast ist. Er verhaspelt sich bei der Arbeitslosenrate oder bei der Zahl der Lehrkräfte in Ohio. In seinem Blick, in den viel zu nah beieinander stehenden Augen liegt kaum wahrnehmbar die panische Angst legasthenischer Kinder, die spüren, dass sie gleich einen Fehler machen werden, für den man sie ausschimpfen wird, doch der Zug ist bereits abgefahren, und sie können ihn nicht mehr stoppen. Wenn er von den Armenvierteln Detroits spricht, runzelt er sorgenvoll die Brauen. Wenn er auf den Irak zu sprechen kommt, setzt er die Miene des harten Hunds auf. Und wenn er das Wort "Amerika" oder "Armee" ausspricht, hüpft er oder, vielmehr, steht er stramm wie zum Fanfarenstoß einer unsichtbaren Trompete. Ich denke an all das Widersprüchliche, was man über seine Beziehungen zum ersten Präsidenten Bush gesagt hat. Und an meine Diskussion neulich abends mit Alan Wolfe über die Frage, ob er den Krieg gegen den Irak führe, um sich zu rächen (Saddam hat meinen Vater gedemütigt, also demütige ich Saddam) oder um einer großen ödipalen Herausforderung gerecht zu werden (das zu Ende bringen, was der Vater nicht geschafft hat - einem anderen Vater zu gehorchen, der über seinem steht und ihm die Entscheidungen souffliert, die er seinem Vater nicht eingeben konnte). In Wahrheit ist dieser Mann ein Kind. Ob er nun von seinem Vater, seiner Mutter, seiner Frau oder vom lieben Gott abhängig ist, heute Morgen macht er mir jedenfalls ganz den Eindruck eines jener erniedrigten Kinder, von denen Georges Bernanos erzählt hat, deren Bösartigkeit von ihrer Schüchternheit herrührt, und ihre Schüchternheit von ihrer Angst. Da heißt es, aufgepasst, dieser verängstigte Junge ist schlau. Ein durchtriebener Bursche. Er ist so geschickt, den Präsidenten der National Urban League, Marc Morial, beim Vornamen anzusprechen und seine Rede gleich nach dem Gebet mit einem Gruß an die Detroit Pistons zu beginnen, den Basketballverein, zu dessen Spitzenmannschaft wie zu den meisten großen Basketballteams in Amerika vorwiegend schwarze Spieler gehören. Er hat das Talent, einen Witz nach dem anderen zu reißen, wie ein Schauspieler ein zögerliches Publikum zu begeistern und über seine eigenen Witze als erster lauthals zu lachen. Er besitzt die geistige Größe, Leute aus dem Publikum ebenfalls bei ihrem Vornamen anzusprechen und gleich den ersten zu ermahnen, "während seiner Rede doch nicht so mit dem Kopf zu schütteln", und den Zweiten, von dem jeder im Saal weiß, dass er drei Mal die Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei verloren hat, mit den Worten zu trösten: "Sie wissen ja, wie hart es ist, für das Präsidentenamt zu kandidieren." - Er hat also die geistige Kraft, das feindselige Verhältnis zu den beiden schwarzen Führern in der ersten Reihe, den Reverends Jesse Jackson und Al Sharpton, von vornherein zu entschärfen. Die National Urban League ist eine eher radikale Organisation. Er befindet sich auf feindlichem Gebiet. Detroit ist eine Stadt, in der, wie er genau weiß, "eine Menge Arbeit auf ihn wartet", um eine Bürgerschaft für sich einzunehmen, die vier Jahre zuvor zu 94 Prozent für Al Gore gestimmt hat. Die 2000 Anwesenden sind gekommen, um die Bestie zu sehen, sie bringen ihm keinerlei Sympathie entgegen. Und dennoch läuft die Sache gut für ihn. Die alte Leier vom "American Dream" und vom "Small Business" verfängt, er hat die Chuzpe, den Behörden in Washington Bürokratie vorzuwerfen, als säße nicht er seit vier Jahren im Weißen Haus, er verbreitet seine Vision von Amerika als einem Unternehmen, an dem alle Amerikaner als Aktionäre beteiligt seien und das jeden immer reicher machen wolle. Schließlich kommt er auf die Krise im Sudan zu sprechen und scheut sich dabei nicht, von Völkermord zu reden, und wenn er wiedergewählt werde, wolle er tun, was in seiner Macht stehe, damit die Verantwortlichen in Khartum so behandelt werden, wie das amerikanische Gesetz es verlange - und es geht gut. Chuzpe und Naivität. Taktisches Geschick und zugleich eine gewisse Treuherzigkeit. Am Ausgang meint ein Delegierter im Gewühl der Radio- und TV-Reporter, die die ersten Eindrücke unter den Besuchern einsammeln: "Der Hurensohn ? er hat uns dran gekriegt ?" Und ein anderer: "Echt stark, der Coup mit dem Sudan!" Genau das lässt auch mich staunen. Und noch befremdlicher ist diese Miene des guten Jungen, des gewieften Burschen, ein bisschen schelmisch, der noch einen Gang zulegen muss, um als Kandidat und Präsident durchzugehen.
Ich stelle ihn mir in seinem Heimatstaat Texas vor, ein kleiner Junge mit großen Problemen, ein mittelmäßiger Schüler, ein Randalierer, der seinen Eltern eine Menge Sorgen macht. Ich stelle ihn mir auf der Phillips Academy und später in Yale vor, so wie Sydney Blumenthal, früher einmal Berater im Weißen Haus und Autor des Buchs The Clinton Wars, ihn mir am Tag zuvor mit einer gewissen Unerbittlichkeit geschildert hat - ich stelle mir vor, wie ihm der hässliche Ruf eines Proteges vorauseilt, auf den die Söhne der Oststaatenaristokratie mit Verachtung herabsehen, die ihn zwar hilfsbereit, aber etwas ungehobelt finden. Anschließend sehe ich ihn ganz lebendig vor mir: ein Provinznarziss, ein unwilliger Dilettant und schlechter Geschäftsmann, ein ewiges Vatersöhnchen, dessen Pleiten die Familie jedes Mal in letzter Sekunde verhindert. Wann hat sich diese Mechanik umgekehrt? Und wie? Unter wessen oder welchem Einfluss hat die Metamorphose stattgefunden, hat sich der Liebhaber von knatternden Autos und Saufgelagen unter Freunden, der Versager, der Biedermann, der Mann, dem man lange Zeit nicht die geringste Chance eingeräumt hätte, seiner prächtigen Mittelmäßigkeit je zu entkommen, in diese Kampfmaschine verwandelt, die in der Lage ist, den schwierigsten Wettkampf Amerikas und des Planeten erst ein Mal, dann ein zweites Mal für sich zu entscheiden? Es gibt Männer - Clinton -, von denen man das Gefühl hat, sie seien zum Präsidenten geboren. Andere - Kennedy -, die dazu erzogen, dressiert wurden. Bei ihm ist das Gegenteil der Fall. Er ist der geborene Verlierer. Er ist darauf dressiert zu versagen. Und für diese Wandlung, diese späte Gnade, die sich noch nicht in seinem Gesicht abgezeichnet hat, hat im Grunde genommen niemand eine Erklärung. Außer ihm. Nämlich dann, wenn er von Gnade spricht. Und von Wiedergeburt. Wer weiß?
Das jüdische Modell für amerikanische Araber
Wie kann man nur Araber sein? Ich meine: Araber und Amerikaner? Wie kann man in Amerika nach dem 11. September seinem muslimischen Glauben treu bleiben und nicht als schlechter Bürger angesehen werden? Für die Bürger von Dearborn, Michigan, wenige Kilometer westlich von Detroit, stellt sich die Frage nicht. Die Stadt ist natürlich ein Sonderfall. Ihr McDonald?s ist halal*. Der Markt heißt Al Dschasira. Der True Gentlemen?s Club, also das Striptease-Lokal, das eingangs des Stadtviertels zwischen dem Restaurant Adonis und der Moschee liegt, versteht sich ausdrücklich als muslimisch. Ich sehe einen alten Ford mit einem jener personalisierten Nummernschilder, auf die die Amerikaner versessen sind, und dessen erste Buchstaben "Taliban" heißen. Und in der Gegend von Fort Rouge, der alten Ford Fabrik, die wie in Lackawanna hauptsächlich nur noch aus rostigen Stahlgerüsten mit nutzlosen Rohren, leeren Lager- und halb zerstörten Montagehallen besteht, aus denen Bäume emporragen, wechselt der typische "Redneck" mühelos vom Arabischen ins Englische und umgekehrt. Doch alle Leute, die ich treffe, alle Kaufleute, Politiker, Kommunalbeamte, die ich danach frage, wie sich in Zeiten von Al-Kaida die beiden Identitäten miteinander vereinbaren lassen, die zwar miteinander verbunden sind, von radikalen Republikanern aber als sich ausschließend angesehen werden, sie alle meinen, dies sei kein Problem und um die Beste aller Welten stehe es bestens. Die Frage nach der doppelten Treuepflicht, die in Frankreich die Diskussion um die kulturelle Zugehörigkeit vergiftet, stellt sich hier überhaupt nicht. Ahmed, der einen Turban trägt wie die Sikhs und an der Warren Avenue Erfrischungsgetränke verkauft, wie sie amerikanischer nicht sein könnten, meint: "Natürlich hat es Probleme gegeben, natürlich hatten wir unter den Nachwirkungen zu leiden, natürlich sind FBI-Beamte gekommen, haben jeden verdächtigt und nach Terroristen gesucht, aber sie haben keine gefunden. Wir sind alle gute amerikanische Bürger, und deshalb konnten sie keine finden." Im großen Konferenzraum des Arab-American Chamber of Commerce, der Arabisch-Amerikanischen Handelskammer, erklärt mir deren Präsident, Nasser M. Beydoun, ein umtriebiger junger Geschäftsmann, der mit einer Französin verheiratet ist und, wie ich erst spät bemerke, "wir Amerikaner" und nicht "wir Araber" meint, wenn er von "uns" spricht: "Ich war gegen den Irakkrieg, aber nicht wegen den Arabern, sondern wegen uns Amerikanern, einem großen Volk, einer wunderbaren Kultur und beispielhaften Demokratie, die nun das Schicksal einer Besatzungsmacht erleidet." Und von Abed Hammoud, dem Präsidenten des Arab-American Politic Act Committee, einer kleinen Einrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kandidaten für alle lokalen und nationalen Machtposten einzuladen, zu befragen und gegebenenfalls zu unterstützen, erfahre ich schließlich: "Als Kerry mich fragte, was er unternehmen müsse, um die Unterstützung der Araber von Detroit zu bekommen, habe ich ihm die Kopie eines Briefes von anderthalb Seiten geschickt, den Bush im Jahr 2000 persönlich an mich schrieb und der mit 'Dear Abed' begann, damit er, Kerry, sich ein Beispiel daran nehmen konnte. Im letzten Januar habe ich dann eine Reihe von Telefoninterviews für ihn organisiert, ebenso wie für Wesley Clark und einen Vertreter Howard Deans. Ich sorge auch dafür, dass eine unserer Gruppen einem bestimmten Kandidaten für den Kongress aus Illinois in seinem Wahlkampf immer auf den Fersen bleibt und noch bei der geringsten Pressekonferenz dabei ist, und heute morgen habe ich einen 'Informationsbrief' an alle unsere Mitglieder fertiggestellt. Und wissen Sie, welchem Modell ich bei all diesen Aktivitäten folge? Dem der Juden natürlich. Die Organisation und der Triumph der jüdischen Lobbyarbeit sind eine unglaubliche amerikanische Erfolgsstory; was die Juden geschafft haben, was sie an Macht gewinnen, im Schweiße ihres Angesichts erwerben konnten, der Weg, den sie beschritten haben und der ihnen Einfluss auf alle Machtzentren gegeben hat, können für uns doch nur Vorbild sein! Sicher, wir sind fünfzig Jahre später dran, aber Sie werden sehen, wir werden es schaffen, eines Tages werden wir auf gleicher Höhe mit ihnen sein."
Ich würde nicht behaupten, dass diese Äußerung ganz unproblematisch ist. Die Mäßigung ist vielleicht rein taktischer Natur, und dahinter mag die Vorstellung stecken, es nicht nur genauso gut, sondern sogar besser zu machen als eine jüdische Gemeinde, die immer noch als Feindbild herhalten muss. Bei Beydoun habe ich zudem eine starke Zurückhaltung hinsichtlich Israel bemerkt, dessen Existenzrecht er wohlweislich nicht in Frage stellt; das Land zu besuchen stehe für ihn aber solange "außer Frage", wie der "palästinensische Widerstand" einschließlich Hisbollah sich nicht gegen die "Besetzung" durchsetzen könne. Aber Tatsache ist, dass wir uns hier in weiter Ferne von Islamberg befinden, jener fundamentalistischen Lebensgemeinschaft, die ich während meiner Nachforschungen über den Tod Daniel Pearls entdeckte und in der man mitten in den Catskill Mountains den Terrorideologen Gilani feierte. Und in noch viel weiterer Ferne von den französischen Vorstädten, in denen man gemeinsam auf die Nationalflagge scheißt, die Marseillaise verhöhnt und wo der Hass auf das Gastland nur noch mit jenem Antisemitismus zu vergleichen ist, der am liebsten sofort losschlagen würde. Das ist die große Lektion, die uns Amerika lehrt, das schöne Spektakel der gelebten Demokratie, das heißt der Integration und des Kompromisses. In einem Umkreis von 15 Kilometern um Dearborn leben 115 000 Araber. In den gesamten Vereinigten Staaten sind es, hauptsächlich über die Bundesstaaten Michigan, Ohio und Illinois verteilt, mehr als eine Million. Und trotz des Irakkriegs, Bushs und der Brandstifter des Kriegs der Kulturen herrschen diese beiden Züge bei ihnen vor: der amerikanische Traum, den sie genauso träumen wie Generationen irischer, polnischer, deutscher und italienischer Einwanderer vor ihnen, und, in engem Zusammenhang damit, jene eigenartige jüdische Leidenschaft, ja, fast Obsession, jene mimetische Rivalität mit einer Gemeinschaft, die, einmal ist keinmal, nicht als Feindbild, sondern als Modell dient, als das obskure Objekt der Begierde - jener Wille, wenn ich mir diese parodistische Wendung einer berühmten Devise der französischen Juden vor der Dreyfus-Affäre erlauben darf, glücklich wie Juden in Amerika zu sein.
-------------------------------
*) "rein" im Sinne des Korans.
Leseprobe Teil 2
Informationen zum Buch und zum Autor hier
Die Rache des kleinen Mannes
Er schafft es nicht, "stem cells", Stammzellen, zu sagen, ohne sich zu versprechen. Er stolpert über Zahlen und Abkürzungen, angefangen bei der National Urban League, einer Organisation von Schwarzen zur Verteidigung der Bürgerrechte, bei der er zu Gast ist. Er verhaspelt sich bei der Arbeitslosenrate oder bei der Zahl der Lehrkräfte in Ohio. In seinem Blick, in den viel zu nah beieinander stehenden Augen liegt kaum wahrnehmbar die panische Angst legasthenischer Kinder, die spüren, dass sie gleich einen Fehler machen werden, für den man sie ausschimpfen wird, doch der Zug ist bereits abgefahren, und sie können ihn nicht mehr stoppen. Wenn er von den Armenvierteln Detroits spricht, runzelt er sorgenvoll die Brauen. Wenn er auf den Irak zu sprechen kommt, setzt er die Miene des harten Hunds auf. Und wenn er das Wort "Amerika" oder "Armee" ausspricht, hüpft er oder, vielmehr, steht er stramm wie zum Fanfarenstoß einer unsichtbaren Trompete. Ich denke an all das Widersprüchliche, was man über seine Beziehungen zum ersten Präsidenten Bush gesagt hat. Und an meine Diskussion neulich abends mit Alan Wolfe über die Frage, ob er den Krieg gegen den Irak führe, um sich zu rächen (Saddam hat meinen Vater gedemütigt, also demütige ich Saddam) oder um einer großen ödipalen Herausforderung gerecht zu werden (das zu Ende bringen, was der Vater nicht geschafft hat - einem anderen Vater zu gehorchen, der über seinem steht und ihm die Entscheidungen souffliert, die er seinem Vater nicht eingeben konnte). In Wahrheit ist dieser Mann ein Kind. Ob er nun von seinem Vater, seiner Mutter, seiner Frau oder vom lieben Gott abhängig ist, heute Morgen macht er mir jedenfalls ganz den Eindruck eines jener erniedrigten Kinder, von denen Georges Bernanos erzählt hat, deren Bösartigkeit von ihrer Schüchternheit herrührt, und ihre Schüchternheit von ihrer Angst. Da heißt es, aufgepasst, dieser verängstigte Junge ist schlau. Ein durchtriebener Bursche. Er ist so geschickt, den Präsidenten der National Urban League, Marc Morial, beim Vornamen anzusprechen und seine Rede gleich nach dem Gebet mit einem Gruß an die Detroit Pistons zu beginnen, den Basketballverein, zu dessen Spitzenmannschaft wie zu den meisten großen Basketballteams in Amerika vorwiegend schwarze Spieler gehören. Er hat das Talent, einen Witz nach dem anderen zu reißen, wie ein Schauspieler ein zögerliches Publikum zu begeistern und über seine eigenen Witze als erster lauthals zu lachen. Er besitzt die geistige Größe, Leute aus dem Publikum ebenfalls bei ihrem Vornamen anzusprechen und gleich den ersten zu ermahnen, "während seiner Rede doch nicht so mit dem Kopf zu schütteln", und den Zweiten, von dem jeder im Saal weiß, dass er drei Mal die Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei verloren hat, mit den Worten zu trösten: "Sie wissen ja, wie hart es ist, für das Präsidentenamt zu kandidieren." - Er hat also die geistige Kraft, das feindselige Verhältnis zu den beiden schwarzen Führern in der ersten Reihe, den Reverends Jesse Jackson und Al Sharpton, von vornherein zu entschärfen. Die National Urban League ist eine eher radikale Organisation. Er befindet sich auf feindlichem Gebiet. Detroit ist eine Stadt, in der, wie er genau weiß, "eine Menge Arbeit auf ihn wartet", um eine Bürgerschaft für sich einzunehmen, die vier Jahre zuvor zu 94 Prozent für Al Gore gestimmt hat. Die 2000 Anwesenden sind gekommen, um die Bestie zu sehen, sie bringen ihm keinerlei Sympathie entgegen. Und dennoch läuft die Sache gut für ihn. Die alte Leier vom "American Dream" und vom "Small Business" verfängt, er hat die Chuzpe, den Behörden in Washington Bürokratie vorzuwerfen, als säße nicht er seit vier Jahren im Weißen Haus, er verbreitet seine Vision von Amerika als einem Unternehmen, an dem alle Amerikaner als Aktionäre beteiligt seien und das jeden immer reicher machen wolle. Schließlich kommt er auf die Krise im Sudan zu sprechen und scheut sich dabei nicht, von Völkermord zu reden, und wenn er wiedergewählt werde, wolle er tun, was in seiner Macht stehe, damit die Verantwortlichen in Khartum so behandelt werden, wie das amerikanische Gesetz es verlange - und es geht gut. Chuzpe und Naivität. Taktisches Geschick und zugleich eine gewisse Treuherzigkeit. Am Ausgang meint ein Delegierter im Gewühl der Radio- und TV-Reporter, die die ersten Eindrücke unter den Besuchern einsammeln: "Der Hurensohn ? er hat uns dran gekriegt ?" Und ein anderer: "Echt stark, der Coup mit dem Sudan!" Genau das lässt auch mich staunen. Und noch befremdlicher ist diese Miene des guten Jungen, des gewieften Burschen, ein bisschen schelmisch, der noch einen Gang zulegen muss, um als Kandidat und Präsident durchzugehen.
Ich stelle ihn mir in seinem Heimatstaat Texas vor, ein kleiner Junge mit großen Problemen, ein mittelmäßiger Schüler, ein Randalierer, der seinen Eltern eine Menge Sorgen macht. Ich stelle ihn mir auf der Phillips Academy und später in Yale vor, so wie Sydney Blumenthal, früher einmal Berater im Weißen Haus und Autor des Buchs The Clinton Wars, ihn mir am Tag zuvor mit einer gewissen Unerbittlichkeit geschildert hat - ich stelle mir vor, wie ihm der hässliche Ruf eines Proteges vorauseilt, auf den die Söhne der Oststaatenaristokratie mit Verachtung herabsehen, die ihn zwar hilfsbereit, aber etwas ungehobelt finden. Anschließend sehe ich ihn ganz lebendig vor mir: ein Provinznarziss, ein unwilliger Dilettant und schlechter Geschäftsmann, ein ewiges Vatersöhnchen, dessen Pleiten die Familie jedes Mal in letzter Sekunde verhindert. Wann hat sich diese Mechanik umgekehrt? Und wie? Unter wessen oder welchem Einfluss hat die Metamorphose stattgefunden, hat sich der Liebhaber von knatternden Autos und Saufgelagen unter Freunden, der Versager, der Biedermann, der Mann, dem man lange Zeit nicht die geringste Chance eingeräumt hätte, seiner prächtigen Mittelmäßigkeit je zu entkommen, in diese Kampfmaschine verwandelt, die in der Lage ist, den schwierigsten Wettkampf Amerikas und des Planeten erst ein Mal, dann ein zweites Mal für sich zu entscheiden? Es gibt Männer - Clinton -, von denen man das Gefühl hat, sie seien zum Präsidenten geboren. Andere - Kennedy -, die dazu erzogen, dressiert wurden. Bei ihm ist das Gegenteil der Fall. Er ist der geborene Verlierer. Er ist darauf dressiert zu versagen. Und für diese Wandlung, diese späte Gnade, die sich noch nicht in seinem Gesicht abgezeichnet hat, hat im Grunde genommen niemand eine Erklärung. Außer ihm. Nämlich dann, wenn er von Gnade spricht. Und von Wiedergeburt. Wer weiß?
Das jüdische Modell für amerikanische Araber
Wie kann man nur Araber sein? Ich meine: Araber und Amerikaner? Wie kann man in Amerika nach dem 11. September seinem muslimischen Glauben treu bleiben und nicht als schlechter Bürger angesehen werden? Für die Bürger von Dearborn, Michigan, wenige Kilometer westlich von Detroit, stellt sich die Frage nicht. Die Stadt ist natürlich ein Sonderfall. Ihr McDonald?s ist halal*. Der Markt heißt Al Dschasira. Der True Gentlemen?s Club, also das Striptease-Lokal, das eingangs des Stadtviertels zwischen dem Restaurant Adonis und der Moschee liegt, versteht sich ausdrücklich als muslimisch. Ich sehe einen alten Ford mit einem jener personalisierten Nummernschilder, auf die die Amerikaner versessen sind, und dessen erste Buchstaben "Taliban" heißen. Und in der Gegend von Fort Rouge, der alten Ford Fabrik, die wie in Lackawanna hauptsächlich nur noch aus rostigen Stahlgerüsten mit nutzlosen Rohren, leeren Lager- und halb zerstörten Montagehallen besteht, aus denen Bäume emporragen, wechselt der typische "Redneck" mühelos vom Arabischen ins Englische und umgekehrt. Doch alle Leute, die ich treffe, alle Kaufleute, Politiker, Kommunalbeamte, die ich danach frage, wie sich in Zeiten von Al-Kaida die beiden Identitäten miteinander vereinbaren lassen, die zwar miteinander verbunden sind, von radikalen Republikanern aber als sich ausschließend angesehen werden, sie alle meinen, dies sei kein Problem und um die Beste aller Welten stehe es bestens. Die Frage nach der doppelten Treuepflicht, die in Frankreich die Diskussion um die kulturelle Zugehörigkeit vergiftet, stellt sich hier überhaupt nicht. Ahmed, der einen Turban trägt wie die Sikhs und an der Warren Avenue Erfrischungsgetränke verkauft, wie sie amerikanischer nicht sein könnten, meint: "Natürlich hat es Probleme gegeben, natürlich hatten wir unter den Nachwirkungen zu leiden, natürlich sind FBI-Beamte gekommen, haben jeden verdächtigt und nach Terroristen gesucht, aber sie haben keine gefunden. Wir sind alle gute amerikanische Bürger, und deshalb konnten sie keine finden." Im großen Konferenzraum des Arab-American Chamber of Commerce, der Arabisch-Amerikanischen Handelskammer, erklärt mir deren Präsident, Nasser M. Beydoun, ein umtriebiger junger Geschäftsmann, der mit einer Französin verheiratet ist und, wie ich erst spät bemerke, "wir Amerikaner" und nicht "wir Araber" meint, wenn er von "uns" spricht: "Ich war gegen den Irakkrieg, aber nicht wegen den Arabern, sondern wegen uns Amerikanern, einem großen Volk, einer wunderbaren Kultur und beispielhaften Demokratie, die nun das Schicksal einer Besatzungsmacht erleidet." Und von Abed Hammoud, dem Präsidenten des Arab-American Politic Act Committee, einer kleinen Einrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kandidaten für alle lokalen und nationalen Machtposten einzuladen, zu befragen und gegebenenfalls zu unterstützen, erfahre ich schließlich: "Als Kerry mich fragte, was er unternehmen müsse, um die Unterstützung der Araber von Detroit zu bekommen, habe ich ihm die Kopie eines Briefes von anderthalb Seiten geschickt, den Bush im Jahr 2000 persönlich an mich schrieb und der mit 'Dear Abed' begann, damit er, Kerry, sich ein Beispiel daran nehmen konnte. Im letzten Januar habe ich dann eine Reihe von Telefoninterviews für ihn organisiert, ebenso wie für Wesley Clark und einen Vertreter Howard Deans. Ich sorge auch dafür, dass eine unserer Gruppen einem bestimmten Kandidaten für den Kongress aus Illinois in seinem Wahlkampf immer auf den Fersen bleibt und noch bei der geringsten Pressekonferenz dabei ist, und heute morgen habe ich einen 'Informationsbrief' an alle unsere Mitglieder fertiggestellt. Und wissen Sie, welchem Modell ich bei all diesen Aktivitäten folge? Dem der Juden natürlich. Die Organisation und der Triumph der jüdischen Lobbyarbeit sind eine unglaubliche amerikanische Erfolgsstory; was die Juden geschafft haben, was sie an Macht gewinnen, im Schweiße ihres Angesichts erwerben konnten, der Weg, den sie beschritten haben und der ihnen Einfluss auf alle Machtzentren gegeben hat, können für uns doch nur Vorbild sein! Sicher, wir sind fünfzig Jahre später dran, aber Sie werden sehen, wir werden es schaffen, eines Tages werden wir auf gleicher Höhe mit ihnen sein."
Ich würde nicht behaupten, dass diese Äußerung ganz unproblematisch ist. Die Mäßigung ist vielleicht rein taktischer Natur, und dahinter mag die Vorstellung stecken, es nicht nur genauso gut, sondern sogar besser zu machen als eine jüdische Gemeinde, die immer noch als Feindbild herhalten muss. Bei Beydoun habe ich zudem eine starke Zurückhaltung hinsichtlich Israel bemerkt, dessen Existenzrecht er wohlweislich nicht in Frage stellt; das Land zu besuchen stehe für ihn aber solange "außer Frage", wie der "palästinensische Widerstand" einschließlich Hisbollah sich nicht gegen die "Besetzung" durchsetzen könne. Aber Tatsache ist, dass wir uns hier in weiter Ferne von Islamberg befinden, jener fundamentalistischen Lebensgemeinschaft, die ich während meiner Nachforschungen über den Tod Daniel Pearls entdeckte und in der man mitten in den Catskill Mountains den Terrorideologen Gilani feierte. Und in noch viel weiterer Ferne von den französischen Vorstädten, in denen man gemeinsam auf die Nationalflagge scheißt, die Marseillaise verhöhnt und wo der Hass auf das Gastland nur noch mit jenem Antisemitismus zu vergleichen ist, der am liebsten sofort losschlagen würde. Das ist die große Lektion, die uns Amerika lehrt, das schöne Spektakel der gelebten Demokratie, das heißt der Integration und des Kompromisses. In einem Umkreis von 15 Kilometern um Dearborn leben 115 000 Araber. In den gesamten Vereinigten Staaten sind es, hauptsächlich über die Bundesstaaten Michigan, Ohio und Illinois verteilt, mehr als eine Million. Und trotz des Irakkriegs, Bushs und der Brandstifter des Kriegs der Kulturen herrschen diese beiden Züge bei ihnen vor: der amerikanische Traum, den sie genauso träumen wie Generationen irischer, polnischer, deutscher und italienischer Einwanderer vor ihnen, und, in engem Zusammenhang damit, jene eigenartige jüdische Leidenschaft, ja, fast Obsession, jene mimetische Rivalität mit einer Gemeinschaft, die, einmal ist keinmal, nicht als Feindbild, sondern als Modell dient, als das obskure Objekt der Begierde - jener Wille, wenn ich mir diese parodistische Wendung einer berühmten Devise der französischen Juden vor der Dreyfus-Affäre erlauben darf, glücklich wie Juden in Amerika zu sein.
-------------------------------
*) "rein" im Sinne des Korans.
Leseprobe Teil 2
Informationen zum Buch und zum Autor hier








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens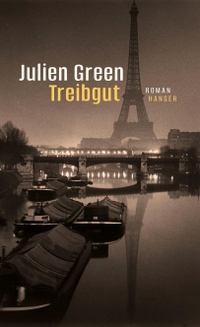 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut