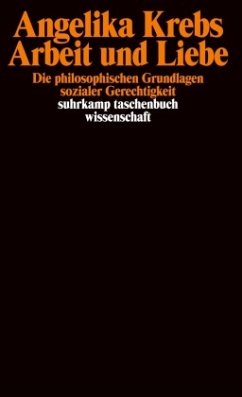»Wer Schweine erzieht, ist ein produktives, und wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft.« Dieses Buch plädiert für die ökonomische Aufwertung von Familienarbeit. Es analysiert den Arbeitsbegriff wie den Liebesbegriff und entwickelt eine humanistische Alternative zur handelsüblichen Vorstellung von Gerechtigkeit als Gleichheit. Auf dieser Basis begründet es das Recht auf ökonomische Anerkennung von Familienarbeit.

Gerechtigkeit ohne Gleichheit: Angelika Krebs’ eigenwillige Begründung für das Erziehungsgeld
Mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wurde die Gleichbehandlung als politisches Gebot formuliert: „All men are created equal. ” Gleichzeitig aber wurde damit der (bis heute) paradigmatische Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit offenbar: gleich sind „alle Menschen” nur auf dem Papier.
Dennoch gilt uns die Gleichheit – als Diskriminierungsverbot oder Gleichheit vor dem Gesetz – als Bedingung einer gerechten Staatsordnung. Umso überraschender ist es, dass Angelika Krebs ihre Forderung nach Anerkennung und Entlohnung der Kindererziehung nicht über den Gleichheitsgrundsatz begründet. Die Professorin für Philosophie an der Universität Basel schließt sich stattdessen der anglo-amerikanischen „Why-Equality?”-Debatte an, die der Gleichheit ihre gerechtigkeitsrelevante Bedeutung abspricht.
Krebs bettet die Frage nach der Gerechtigkeit in eine Neubestimmung der Begriffe Arbeit und Liebe ein. Wenn Frauen Kinder bekommen und Jahre für die Erziehung aufwenden, statt sich ihrer Karriere zu widmen, werde dies mit der Verwirklichung der weiblichen Natur oder der Liebe zum Kind erklärt, beschreibt Krebs einen weithin gültigen Status quo. Diese „gesellschaftliche Zuweisung” definiere die Kindererziehung als Privatsache und lasse eine gesellschaftliche Entlohnung wie von „echter” Arbeit unsinnig erscheinen.
Darum schlägt sie einen „institutionellen Arbeitsbegriff” vor, der auch Tätigkeiten umfaßt, die zwar einen Nutzen für andere haben, „aber außerhalb der gesellschaftlichen Organisation des Gebens und Nehmens stehen”. Womit sie dem ökonomischen Verständnis von Arbeit widerspricht, das die Kindererziehung per se von der Entlohnung ausschließt, da sie im Privaten statt findet. Und gegen die vorherrschende Auffassung der Liebe als selbstlos und aufopfernd betont Krebs den Aspekt des „eigeninteressierten Tausches”: wer gibt möchte auch empfangen. Die Notwendigkeit, sowohl den Arbeits- wie auch Liebesbegriff auszuweiten und zu modifizieren, begründet Krebs mit der grundsätzlichen Abhängigkeit jeder Gesellschaft von Nachwuchs.
Wichtig wie ein Müllmann
So sehr Krebs mit ihrer Forderung Recht hat, die Kindererziehung als Arbeit anzuerkennen und zu entlohnen, so wenig kann ihr Weg überzeugen. Denn die Ausweitung des Arbeitsbegriffs auf das Private und die Integration der Liebe in den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess hätten unerwünschte „Nebenwirkungen”: die öffentlich anerkannte Bezahlung von „Tätigkeiten”, von denen man dies eigentlich nicht wollen kann.
Krebs versteht Gleichheit ausschließlich „relational”, also im Vergleich zu etwas anderem. Folglich, so ihre Kritik, sei beispielsweise Hungernden nur darum zu helfen, weil andere mehr zu essen haben, nicht aber weil Hunger an sich, also normativ gesehen, schlecht sei. Dabei übersieht sie, dass das Gleichheitsgebot im Kern eine normative Forderung ist, die sich nicht im Relativen erschöpft. Als Thomas Jefferson in der Unabhängigkeitserklärung die Gleichheit aller Menschen postulierte, ging es ihm um die Gleichheit der Rechtssubjekte: dass alle Menschen Träger gleicher und unveräußerlicher Rechte sind. Eine normative, keine relative Forderung.
Allein mit dem Verweis auf das Gebot der Gleichbehandlung, dass die Kindererziehung einen ebenso wichtigen Beitrag zum Erhalt der Gesellschaft wie der Informatiker oder der Müllmann leistet, ließe sich Krebs’ Forderung begründen. Nur wird man dies bei ihr nicht finden.
ANDREAS BOCK
ANGELIKA KREBS: Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. 323 Seiten, 12 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Warum erhält der Arbeiter im Weinberg, der erst in der elften Stunde beginnt, genausoviel Lohn wie der Arbeiter, der schon seit dem frühen Morgen schuftet? Es gibt drei Möglichkeiten, die Ungerechtigkeit im Gleichnis zu deuten. Die funktionalistische Deutung ist kaltherzig: In der ungerechten Bezahlung spiegeln sich die Zufälligkeiten von individuellen Motivationen und konjunkturellen Marktgegebenheiten. Die theologische Deutung ist grausam: Die Ungerechtigkeit ist die paradoxe Erscheinungsform eines - wenn auch undurchschaubaren - höheren Willens, eines Wesens, das dem Dasein einen oft nicht nachvollziehbaren Sinn verleiht und für das es nie zu spät ist, eine Gnade zu erlangen, die nicht von unseren Werken und Taten abhängt. Die moralphilosophische Deutung ist ehrlich: Sie nennt die schreiende Ungerechtigkeit beim Namen und beschreibt die gleiche Entlohnung als Kränkung. Die funktionalistische Deutung verletzt unser Gefühl, die theologische beleidigt unseren Verstand. Die moralphilosophische Interpretation hingegen demütigt beide. Denn weder gönnt sie den Privilegierten Genuß, noch spendet sie den Zukurzgekommenen Trost. Das ist demoralisierend. Wozu also brauchen wir eigentlich Moralphilosophie? Jedenfalls bringt sie den sich stets verfeinernden, sich weiter ausdifferenzierenden Klassenkampf der Privilegierten mit den Zukurzgekommenen auf immer neue Begriffe. So etwa die Basler Philosophieprofessorin Angelika Krebs in ihrer Studie "Arbeit und Liebe". Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit (Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2002. 323 S., br., 12,- [Euro]). Ihr Beitrag zur genaueren Wahrnehmung der politischen Welt ist die Unterscheidung zwischen zwei Arten von "Familienarbeit": Fürsorgeleistungen für Kinder, Alte und Kranke einerseits sowie Fürsorgeleistungen für erwachsene, gesunde Personen - also Männer - andererseits. Das Problem der Aufteilung von Hausarbeit, das so viele Ehen, Partnerschaften und Wohngemeinschaften belastet, hebt die Autorin auf eine neue Stufe begrifflicher Entflechtung. Sie versucht sich einer Lösung des Problems zu nähern, daß die Gesellschaft Hausarbeit nicht als Arbeit anerkennt, wodurch sich diejenigen, die sie verrichten müssen - meist Frauen -, natürlich gedemütigt fühlen. Der radikalfeministische Vorschlag, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, besteht darin, Hausarbeit durch einen wohl vom Staat zu entrichtenden Lohn zu bezahlen. Dieser Vorschlag sieht sich dem moralphilosophischen Einwand ausgesetzt, daß seine Verwirklichung die auf Zuneigung basierenden informellen familiären und partnerschaftlichen Beziehungen formalisieren und damit möglicherweise abtöten würde. Aus der mit reichlich theoriegeschichtlichem Pomp gekleideten Unterscheidung von Angelika Krebs dagegen folgt die politische Forderung, daß Pflege-, Fortpflanzungs- und Erziehungsdienstleistungen zu entlohnen seien, denn diese Leistungen dienten der Reproduktion der Gesellschaft und seien nicht ersetzbar. Sie entzögen sich gewissermaßen der individuellen Willkür, sie seien gesellschaftlich notwendig. Ein Grundeinkommen für die Produktion des öffentlichen Gutes Kindererziehung und Altenpflege würde solche Tätigkeiten als Arbeit anerkennen und dadurch Mütter mit ihren Ehegatten gleichstellen. Anders verhält es sich mit Dienstleistungen wie dem Waschen, Einkaufen, Kochen, Putzen oder Sexualität: Die mit dieser von der Autorin so genannten "Partnerarbeit" verbundene Demütigung sei nur durch Liebe kompensierbar. Denn womit, so fragte einmal André Gide, soll sich der Mensch nach einer Erniedrigung trösten, wenn nicht mit dem, was ihn erniedrigt hat? An den Grenzen der Liebe, so Krebs, müsse Gerechtigkeit haltmachen, und sie unterscheidet zwei Arten unbezahlter erzwungener Arbeit, also Sklaverei: "Familienarbeit" und "Partnerarbeit". Doch nach diesem Durchgang durch moralphilosophische Unterscheidungen fühlen wir uns wieder an die Kaltherzigkeit und die Grausamkeit funktionalistischer und theologischer Weltdeutungen verwiesen. Einerseits an die Frage nach dem (vermutlich zunehmenden) volkswirtschaftlichen Nutzen einer Emanzipation der Frauen, andererseits an die Frage nach dem metaphysischen Sinn der Liebe.
CHRISTOPH ALBRECHT
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Restlos zufrieden ist Michael Schefczyk mit diesem Buch der Basler Philosophieprofessorin Angelika Krebs nicht. Seiner Auffassung nach läuft die Egalitarismuskritik der Autorin dort ins Leere, wo sie nahe legt, den Egalitaristen sei entgangen, es komme darauf an, ob Menschen ein gutes Leben führten, und nicht, wie deren Leben relativ zu dem Leben anderer stehe. Dem Rezensenten drängt sich am Ende der Verdacht auf, der des Hauses verwiesene Egalitarismus steige durchs Fenster wieder ein. Überzeugender findet Schefczyk die Ausführungen der Autorin "zu der pekuniären Anerkennung von Familienarbeit". Hier lasse sich Krebs "von dem ideologischen Schwindel mit dem romantischen Liebesbegriff" nicht irremachen. Für philosophische Studien ungewöhnlich, pflege Krebs ein Interesse am politischen Detail und gehe auch auf vorliegende Machbarkeitsstudien zur entlohnten Familienarbeit ein. Ein Stil, meint der Rezensent, der Anschluss an die einzelwissenschaftliche Forschung erlaube. In dieser Hinsicht hätte es "sogar noch etwas mehr sein können".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH