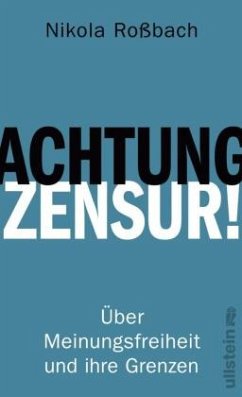Zensur ist der Schlachtruf der Stunde: Ein Gedicht wird von einer Fassade entfernt? Zensur! Ein Bild aus einem Museum entfernt? Zensur! Ein Redner von einer Universität ausgeladen? Zensur! Doch ist es das wirklich? Viele haben heute das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr offen sagen zu können. Sie fragen sich, ob Facebook und Google ihre Kontrollaufgaben nicht rigider wahrnehmen als mancher Staat, ob Kunst politisch korrekt sein muss, wieviel Freiheit man den Feinden der Freiheit geben kann.
Eine heiße Debatte ist entbrannt, bei der vieles durcheinander geht. Klassische Zensur vermischt sich mit neuen Formen, polemisches Geschrei von rechts mit Sprechverboten von links. Die Literaturwissenschaftlerin Nikola Roßbach analysiert die kontroverse Diskussion um das Sagbare und legt die unterschwelligen Mechanismen unserer Gesellschaft offen. Zugleich fordert sie eine Zensurdebatte, die über Polemiken und effektheischende Extrempositionen hinausgeht. Eine Auseinandersetzung, diezeigt, was Meinungsfreiheit bedeutet und wie viel sie uns tatsächlich wert ist.
Eine heiße Debatte ist entbrannt, bei der vieles durcheinander geht. Klassische Zensur vermischt sich mit neuen Formen, polemisches Geschrei von rechts mit Sprechverboten von links. Die Literaturwissenschaftlerin Nikola Roßbach analysiert die kontroverse Diskussion um das Sagbare und legt die unterschwelligen Mechanismen unserer Gesellschaft offen. Zugleich fordert sie eine Zensurdebatte, die über Polemiken und effektheischende Extrempositionen hinausgeht. Eine Auseinandersetzung, diezeigt, was Meinungsfreiheit bedeutet und wie viel sie uns tatsächlich wert ist.

Ein Phänomen, das beide Seiten des politischen Spektrums im Griff hat: Nikola Roßbach untersucht Redeverbote im Zeitalter der freien Meinungsäußerung.
Von Manfred Koch
Am Anfang war, wie so oft, Gutenberg. Es war nicht zufällig der Erzbischof von Mainz, der 1485 die ersten zensurrechtlichen Bestimmungen im Heiligen Römischen Reich erließ. 1496 setzte Kaiser Maximilian I. den ersten hauptamtlichen Zensor ein. Mit dem neuen Berufsstand der Drucker war auch derjenige der Staatsdiener geboren, die die beängstigende Vermehrung und Verbreitung aller möglichen Schriften wieder eindämmen sollten. Über Jahrhunderte hinweg hatten sie beträchtlichen Einfluss auf die Formung der "öffentlichen Meinung", der Instanz, die seit der Aufklärung als wesentlicher Faktor der Gesetzgebung im modernen Rechtsstaat gilt.
Die Kasseler Germanistin Nikola Roßbach gibt zu Beginn ihres Buchs nur einen knappen Überblick über die Geschichte der Zensur von der Antike bis zum Untergang der DDR. Im Zentrum steht die Frage nach den Folgen der aktuellen Medienrevolution. Erzwingt die entfesselte digitale Kommunikation neue Formen der Überwachung und, wenn ja, wo spielen sie sich ab, wer ist ihr Träger und inwiefern sind sie gerechtfertigt? "Eine Zensur findet nicht statt", heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Gebot kann nach Roßbach in Deutschland als praktisch verwirklicht gelten, soweit es um die "klassische", von Staatsorganen betriebene Einschränkung der Meinungsfreiheit geht.
Wie aber steht es mit der "informellen Zensur" in all ihren Schattierungen, der Begrenzung des Sagbaren durch Anstandsregeln, Geschäftsinteressen, politischer Parteinahme? Paradoxerweise geht das Verschwinden der staatlichen Zensur ja einher mit einem unter den befreiten Bürgern zunehmend verbreiteten Gefühl, nicht mehr sagen zu dürfen, was einen umtreibt, gerade in den wichtigen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens unerträglichen Redeverboten zu unterliegen. Zensur ist, so Roßbach, "zum inflationär verwendeten Kampfbegriff in der Politik, ebenso wie in Kunst und Kultur" geworden. Das Phänomen, dass "von Zensur nichts in Sicht, aber viel die Rede ist", bildet den eigentlichen Gegenstand ihres Buchs; es ist, wie sie als Literaturwissenschaftlerin erwartbar formuliert, eine Untersuchung des "Zensurdiskurses" nach dem Ende der realen, "klassischen Zensur".
Es ist damit über weite Strecken auch eine Studie zur politischen Korrektheit. Behandelt werden zunächst einige exemplarische Debatten der letzten Jahre über Einschränkungen der Kunstfreiheit aus Rücksichtnahme auf empörte Reaktionen aus dem Lager des Feminismus und des Postkolonialismus. Es folgen Kapitel zur geschlechtergerechten Sprache, zu den"speech codes" der nordamerikanischen Universitäten sowie zur Manipulation der Meinungsbildung durch Medienimperatoren wie Rupert Murdoch oder Silvio Berlusconi.
Das Buch schließt mit einer fundierten Kritik an dem 2017 verabschiedeten "Netzdurchsetzungsgesetz", das, wie Roßbach zurecht moniert, die gute Absicht, das Internet endlich einer verbindlichen Rechtsordnung zu unterwerfen, mit untauglichen Mitteln verfolgt: Der Staat stiehlt sich aus der Verantwortung, indem er die Rechtsdurchsetzung an die privaten Provider delegiert, wodurch die Internetgiganten eher gestärkt als geschwächt werden. Die bedrohliche Steuerung der meinungsbildenden Kommunikationsflüsse durch ihre ökonomische und technische Macht kann sich so womöglich noch wirksamer entfalten.
Roßbach ist da am überzeugendsten, wo sie die Entleerung des Zensurbegriffs durch seine inflationäre Verwendung anprangert und für terminologische Trennschärfe plädiert. So ist, wie sie lakonisch festhält, die Entfernung des angeblich machistischen Eugen-Gomringer-Gedichts "avenidas" von der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule kein Akt der Zensur, weil der Text ja allgemein zugänglich bleibt (und - ein bekannter Effekt - seitdem massenhaft gelesen wird).
Ebenso wenig handelt es sich um Zensur, wenn die amerikanische Künstlerin Hannah Black in einem offenen Brief die Entfernung und Zerstörung eines Gemäldes ihrer Kollegin Dana Schutz fordert, weil hier eine weiße Frau sich das Leid der Afroamerikaner - das Bild zeigt einen von weißen Rassisten ermordeten und verstümmelten schwarzen Jungen - zum Zweck der Karriereförderung angeeignet habe. Denn das Museum war natürlich nicht gehalten, diese Forderung zu erfüllen, sowenig wie anderswo die Kuratoren auf die vermehrten Vorhaltungen, sie stellten sexistische, pädophile oder rassistische Bilder aus, mit deren Entfernung reagieren. Die Bilder bleiben hängen, die Diskussion über sie geht weiter, und beides ist gut so.
Allerdings hätte man sich hier eine kulturgeschichtliche Vertiefung zum Thema "Political Correctness in den Vereinigten Staaten" gewünscht. Wenn Roßbach die "campus guidelines" der dortigen Universitäten vorstellt und von Jura-Dozenten berichtet, die das Wort "violate" nicht mehr verwenden dürfen, weil traumatisierte Studentinnen daran Schaden nehmen könnten, klingt das für europäische Leser nur wie Nachrichten aus Absurdistan. Wie es zu solchen Empfindlichkeitsexzessen kam, wie Political Correctness im Anschluss an die Bürgerrechtsbewegung der sechziger Jahre zu einer Forderung linker Politiker und Intellektueller nach Anerkennung der Minoritäten wurde, wie der Begriff dann aber bereits in den achtziger Jahren von den Konservativen vereinnahmt und zum eigenen Kampfbegriff umfunktioniert wurde, mit dem man sich nun trefflichals Opfer einer linken Gesinnungstyrannei ausgeben konnte - darüber erfährt man bei Roßbach nichts.
Dabei wird an dieser Geschichte greifbar, was das Problem auf beiden Seiten des politischen Spektrums ist: die Anmaßung eines Opferstatus, wo de facto keine Unterdrückung vorliegt. Im Lager der Minoritäten kultivieren viele einen Narzissmus, der sie die Umwelt geradezu zwanghaft nach symbolischen Kränkungen absuchen lässt; im rechten Lager schreit man "Zensur" und "Gedankenpolizei", wo es sich schlicht um Widerrede gegen - meist bewusst provozierende und oft schamlose - Behauptungen handelt.
Nun waren - und sind bis auf den heutigen Tag - Frauen, Migranten, Homosexuelle (um nur diese drei Gruppen zu nennen) immer wieder Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt. Wie unterscheidet man da die berechtigte Empörung von jener dogmatischen Hypersensibilität, die letztlich, nach amerikanischem - Vorbild, die Welt als umfassenden "safe space" einrichten will, wo dem Traumabereiten keinerlei Zumutung mehr droht? Entscheiden lässt sich das nur im Einzelfall. Roßbach ist bei den Beispielen, die sie anführt, um kritische Empathie bemüht, die manchmal zu umständlichen Einerseits-andererseits-Argumentationen führt.
So verteidigt die Autorin bei der Debatte um das Gomringer-Gedicht die Studentinnen, die seine Entfernung verlangten, gegen den Vorwurf der Kunstbarbarei, hält aber zugleich fest, es handle sich um ein "schönes und kulturhistorisch wertvolles" Werk, weshalb sie sein Verschwinden von der Fassade bedauere. Verfehlt sei dennoch der hochmütige Ton, in dem der PEN-Club die Studentinnen abgekanzelt habe. Mit Verlaub: Auch wenn tatsächlich niemand zu Kunstkennerschaft verpflichtet werden kann, die angehenden Sozialarbeiterinnen dieser Hochschule also jedes Recht hatten, ihre Fassade mit weniger komplexen Dingen zu schmücken als einem modernen Gedicht, sollte eine Literaturwissenschaftlerin doch wenigstens deutlich sagen, was hier vorliegt - keine Zensur, das gewiss nicht,aber ein Akt ästhetischer Dummheit.
Nikola Roßbach: "Achtung Zensur!" Über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen.
Ullstein Verlag, Berlin 2018.
267 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main