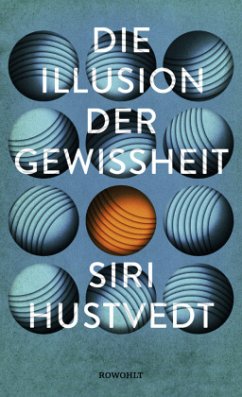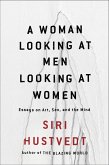Produktdetails
- Verlag: Rowohlt, Hamburg
- Artikelnr. des Verlages: 21138
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 416
- Erscheinungstermin: 11. Mai 2018
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 134mm x 32mm
- Gewicht: 495g
- ISBN-13: 9783498030384
- ISBN-10: 3498030388
- Artikelnr.: 50099962

In dem Essay „Die Illusion der Gewissheit“ denkt Siri Hustvedt über die Bedingungen der Wahrnehmung nach
Die amerikanische Autorin Siri Hustvedt führt ein publizistisches Doppelleben. Sich selbst nennt sie eine intellektuelle Vagabundin, eine Weltenwanderin zwischen den Disziplinen. Ihre Romane und Essays haben tatsächlich oft etwas von geistigen Reisen, die sowohl ihre Figuren als auch ihre Leser in Gedankenschleifen und Assoziationsketten mit existenziellen Fragen der Selbst- und Fremdwahrnehmung konfrontieren. In ihrem Roman „Die gleißende Welt“ (2015) etwa heuert die fiktive Künstlerin Harriet Burden drei Männer an, um sie als lebende Pseudonyme für ihr eigenes Werk einzusetzen und so die Misogynie der Kunstwelt anzuprangern.
Statt Eindeutigkeit sucht Hustvedt bewusst den Schwebezustand der Vielstimmigkeit, ihr Schreiben entsteht aus einem grundsätzlichen Zweifel absoluten Setzungen gegenüber. Sie befragt die Welt immer im Wissen darum, dass sie ihre persönliche Perspektive nicht ausblenden kann. Deshalb bezieht sie sie selbstbewusst und selbstreflexiv in ihr Nachdenken ein. Ihr 2010 erschienener autobiografischer Essay „Die zitternde Frau“, in dem sie ihre eigene Nervenkrankheit analysierte, fand auch in der medizinischen Fachwelt großen Anklang. Seitdem veröffentlicht die promovierte Anglistin regelmäßig wissenschaftliche Aufsätze in den Bereichen Philosophie, Psychologie und Neurowissenschaften, seit 2015 ist sie auch Dozentin für Psychiatrie.
Bisher liefen ihre literarischen und wissenschaftlichen Projekte scheinbar parallel nebeneinander her. Mit ihrem neuen, sehr persönlichen Essay „Die Illusion der Gewissheit“ schlägt sie jetzt die Brücke zwischen den vermeintlich gegensätzlichen Polen. Dabei knüpft sie direkt an einige Aspekte aus „Die gleißende Welt“ an: Harriet Burdens Alter Ego, die britische Philosophin Margaret Cavendish, ist auch hier die Hausheilige, an deren Naturphilosophie Hustvedt sich orientiert. Der beinahe 400 Seiten starke Text ist ein Versuch über das Leib-Seele-Problem, also die Erklärungslücke, die zwischen dem Gehirn und dem Geist aufklafft. Wo im Körper ist das Bewusstsein anzusiedeln, wo die Moral? Sind diese in bestimmten Teilen des Gehirns auszumachen oder jenseits jeder Materialität? Wie ist es möglich, dass Geist und Körper Einfluss aufeinander haben, wenn es keine Einwirkung von außen gibt, etwa beim Placebo-Effekt eines Medikaments? Sie befragt dabei zunächst klassische Erkenntnistheoretiker wie Descartes und Hobbes, sucht jedoch auch bei unbekannten Philosophen, bei Biologen, Medizinern und Genetikern, bei Physikern, Kognitions- und Neurowissenschaftlern nach neuen Perspektiven auf ein und dasselbe Ausgangsproblem.
Hustvedt entlarvt die grundsätzliche Problematik dichotomischen Denkens, mit dem die Wissenschaft seit der Antike die Zusammenhänge vereinfacht. Sie macht die kartesianische Trennung von Körper und Geist verantwortlich für die im westlichen Denken vorherrschende, meist unbewusst vorgenommene Trennung und Hierarchisierung von Rationalität und Sinnlichkeit, Natur- und Geisteswissenschaft sowie Männlichkeit und Weiblichkeit. Das ist der Grundsatzvorwurf, den Siri Hustvedt in ihren Essays durchspielt.
Dabei identifiziert sie Brüche und Leerstellen, die sich ergeben, wenn man ein Problem nur aus einer Perspektive betrachtet. Bis heute gibt es beispielsweise die gängige Metapher vom menschlichen Gehirn als Computer, bei dem die genetische Disposition als Verkabelung gedacht wird. Das Bild suggeriert, dass auch Persönlichkeitsmerkmale fest verdrahtet sind, ähnlich wie bei einer Maschine. Doch gibt es nur wenige Hinweise darauf, dass die Persönlichkeit genetisch festgelegt ist, vielmehr wird sie von äußeren Einflüssen bedingt und bleibt immer im Fluss. Jeder Forschungsbereich ist von einer eigenen Sprache geprägt, die sich nicht notwendigerweise mit den Begrifflichkeiten der Nachbardisziplinen decken muss, auch dadurch entstehen hartnäckige Missverständnisse. Wissenschaftliche Gewissheit innerhalb eines Fachbereichs wird so zu einer sprachlichen Illusion. Anhand anschaulicher Beispiele und Studien, aber auch eigener Erfahrungswerte, zeigt Hustvedt, dass objektives Forschen weder in den Natur- noch in den Geisteswissenschaften möglich ist. Durch die permanenten Perspektivwechsel aber entsteht eine Haltung selbstreflexiver Distanz, die sich auf dynamische Prozesse statt Dichotomien verlässt und so neue Lösungsansätze für bestehende Probleme ermöglicht.
In dem Kapitel „Frauen können keine Physik“ hinterfragt sie den in vielen Studien nahegelegten Geschlechterunterschied in den Naturwissenschaften, der oft durch die bei Männern angeblich biologisch besser ausgebildete Fähigkeit des dreidimensionalen Vorstellungsvermögens begründet wird. Hustvedt vergleicht eine Vielzahl von Studien und kommt zu dem Schluss, dass diese Leistungsunterschiede durchaus gewissen Moden unterworfen sind, es sich also nicht um ein biologisches Phänomen handelt, sondern um ein kulturelles. Die Ergebnisse dieser Studien erklären sich nicht zuletzt dadurch, dass die wissenschaftlichen Disziplinen Biologie und Kultur trennen, statt beide Bereiche zu berücksichtigen. Von Objektivität kann schwerlich die Rede sein. Die Ergebnisse gehen aus der Fragestellung hervor. Hustvedt zeigt auch, dass Frauen schlechter abschneiden, wenn man ihnen vorher sagt, dass Männer die Aufgaben grundsätzlich besser lösen.
Auch wenn die Fülle und Tiefe dieses Essays auf den ersten Blick unbezwingbar erscheint, erleichtert seine netzwerkartige Struktur den Einstieg. Die thematischen Perspektiven, die Hustvedt hier öffnet, sind zwar einer groben historischen Chronologie unterworfen, doch die netzwerkartige Struktur des Essays ermöglicht es, in nahezu jedem Kapitel einzusteigen oder querzulesen, um sich von bekannten Theorien und Themen in unbekannte Forschungsgebiete vorzuarbeiten.
Siri Hustvedts umfassendes interdisziplinäres Wissen und ihre Arbeit in den oft getrennt agierenden Bereichen der Natur- und Geisteswissenschaften verleihen ihr eine beneidenswerte gedankliche Flexibilität. Es ist eine reine Freude, ihr dabei zuzusehen, wie sie bestehende Forschungsbereiche und -positionen miteinander in Beziehung setzt. „Die Illusion der Gewissheit“ liest sich wie eine hybride Poetik des Geistes, hier münden Hustvedts literarisches Werk und ihre wissenschaftlichen und philosophischen Essays in eine ganz eigene Variante poetischer Gelehrsamkeit.
SOFIA GLASL
Hustvedt weiß, dass
sie ihre eigene Perspektive
nicht ausblenden kann
Die Geschlechterunterschiede
in den Naturwissenschaften sind
durchaus Moden unterworfen
In ihren Essay versöhnt die Schriftstellerin Siri Hustvedt kunstvoll die wissenschaftlichen Disziplinen.
Foto: imago/Agencia EFE
Siri Hustvedt: Die Illusion der Gewissheit. Aus dem Englischen von Bettina Seifried. Rowohlt Verlag, Reinbek 2018, 416 Seiten, 24 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Aus eigener Erfahrung: Siri Hustvedt sichtet die Literatur der Hirnforschung
Für Wittgenstein war es durchaus vorstellbar, "dass bei einer Operation mein Schädel sich als leer erwiese". Mit diesem absurd anmutenden Zweifel wollte der Philosoph vielleicht daran erinnern, dass wir es in aller Regel als selbstverständlich hinnehmen, ein Gehirn zu haben, ohne uns dafür auch nur für eine Sekunde Rechenschaft abzulegen. Dass wir ein Gehirn haben, wird uns vor allem dann bewusst, wenn es nicht richtig funktioniert.
Diese Erfahrung musste auch die Schriftstellerin Siri Hustvedt machen, als sie vor einigen Jahren aus heiterem Himmel anfing, vom Hals abwärts zu zittern, und zwar vor allem dann, wenn sie an ihren verstorbenen Vater dachte. Sie schrieb ein lesenswertes Buch über ihr Leiden, in dem sie zwar auch von sich selbst erzählte, vor allem aber ging sie den möglichen neuropsychologischen Ursachen des Zitterns nach und arbeitete sich dazu in die entsprechende neurologische und psychiatrische Fachliteratur von Jean-Martin Charcot bis Antonio Damasio ein.
Seit dem Ausbruch dieser Krankheit, die sie mit Betablockern in Schach hält, hat sich Siri Hustvedt immer weiter in die Neurowissenschaften eingelesen. Sie entwickelte dabei ein wachsendes Unbehagen angesichts der Art und Weise, wie in der akademischen Öffentlichkeit über das Gehirn geredet wird. Die Diagnose, die sie in ihrem Essay "Die Illusion der Gewissheit" (wer mag, wird die Anspielung auf Freud nicht überlesen) stellt, ist völlig richtig: Ständig hört und liest man von kompetenten und manchmal auch weniger kompetenten Hirnarbeitern, wie das Geist-Gehirn funktioniert. Man wird etwa belehrt, dass unser Verhalten durch die evolutionäre Entwicklung unseres Gehirns geprägt wird oder dass die faktischen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen den Unterschied zwischen Mann und Frau weitgehend erklären.
Gegen diese Meinungsgewissheit, die so tut, als ob bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich alles geklärt sei, erinnert Hustvedt einmal mehr daran, dass trotz aller Fortschritte auf dem Gebiet der Hirnforschung entscheidende Fragen eben noch nicht geklärt sind, dass bei manchen Fragen noch nicht einmal klar ist, wie sie überhaupt vernünftig zu formulieren wären. Davon ausgehend knöpft sie sich die weitverbreiteten Doktrinen über die "vorprogrammierten" Strukturen im Gehirn vor, die Hypothesen als Fakten verkaufen. Bestsellerautoren wie Steven Pinker oder Daniel Dennett werden ebenso kritisch unter die Lupe genommen wie die Vertreter der Evolutionspsychologie und der Kognitionswissenschaften, die ein Computermodell des Gehirns vertreten und sich in ihrer radikalsten Zuspitzung auf die Erwartung kaprizieren, ihren Geist vom Gehirn auf eine Festplatte zu transferieren.
All diese Kritik ist völlig berechtigt, und besonders lesenswert sind die Abschnitte, in denen sie mit Mary Douglas' Theorie zu Reinheit und Verunreinigung der Künstlichen Intelligenz zu Leibe rückt. Nur: Neu ist das meiste davon nicht. Es fehlt nicht an gewichtigen Einsprüchen gegen den maßlosen Neurohype der letzten fünfundzwanzig Jahre, und auf einige dieser Kritiker bezieht sich Hustvedt auch. Wofür sie sich leider nicht interessiert, sind die praktischen Auswirkungen dieses Hypes auf den Alltag, die von der automatisierten Gesichtserkennung bis zu den Milliardengeschäften mit Neuroenhancement reicht. Von hier aus käme man nämlich zu der Einsicht, dass die Neurowissenschaften sehr wohl politischen und ökonomischen Interessen dienen, und genau diese Zusammenhänge gälte es, besser zu verstehen.
Stattdessen entwickelt die Autorin ihre eigenen Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Geist und Gehirn, die an Neuropsychologen wie Oliver Sacks und Antonio Damasio sowie an die Neurophänomenologie Francisco Varelas angelehnt sind, auch wenn sie bei Letzterem dessen buddhistisch inspirierte Infragestellung des wesenhaften Selbst etwas unheimlich findet. Wiederum ist gegen eine solche holistische beziehungsweise die Emotionen integrierende Perspektive erst einmal nichts zu sagen. Doch wenn Hustvedt der von Wolf Singer vorgeschlagenen These, wonach das Gehirn ein Welt schaffendes und Bedeutung generierendes Organ sei, vorhält, dass dies so neu nicht sei, dann trifft das für ihre Ausführungen in noch viel höherem Maße zu, und das macht die Lektüre mitunter etwas mühsam.
Anstatt diese Redundanz der Autorin zum Vorwurf zu machen, ist es wohl erkenntnisfördernder, hierin ein Symptom zu sehen. Über das Gehirn und seine Relevanz für unser Menschsein ist in den letzten Dekaden so viel geschrieben worden, dass es unter den gegenwärtigen paradigmatischen Grundannahmen nicht mehr viel Neues hinzuzufügen gibt, auch nicht für eine so gewissenhafte Autorin wie Siri Hustvedt. Wenn aber das mehr oder weniger Bekannte nur noch einmal aufbereitet wird, folgt daraus, dass es vorläufig nicht mehr allzu ergiebig ist, sich mit diesem Gegenstand weiter zu befassen. Erkenntnisgegenstände haben ihre eigene Historizität: Sie steigen auf, haben ihre Konjunktur, und irgendwann beginnen sie wieder zu verblassen. Es deutet viel darauf hin, dass dem Gehirn - falls nicht den Neurowissenschaften ein spektakulärer Coup gelingt, was nicht zu erwarten, aber natürlich nie auszuschließen ist - gegenwärtig genau das passiert.
Damit keine Missverständnisse entstehen: Das heißt nicht, dass sich nicht auch weiterhin viele Menschen professionell mit dem Gehirn befassen werden. Das heißt auch nicht, dass nicht weiterhin sehr viel Geld in die Neurowissenschaften gesteckt wird, um die zur Genüge vorhandenen offenen Fragen weiter zu erforschen. Das heißt nur, dass die Fokussierung auf das Gehirn als den Ort, der quasi ausschließlich über Wohl und Wehe der conditio humana entscheidet, sich selbst erledigt. Der lange Sommer des Gehirns scheint erst einmal an ein Ende zu kommen, und das ist auch gut so.
MICHAEL HAGNER
Siri Hustvedt: "Die Illusion der Gewissheit".
Aus dem Englischen von Bettina Seifried. Rowohlt Verlag, Reinbek 2018. 416 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Als Essayistin ist Siri Hustvedt unvergleichlich. The Sunday Telegraph