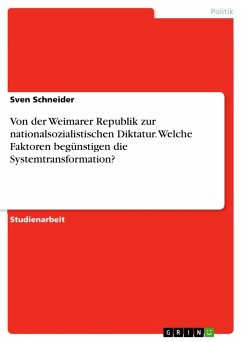Ende der achtziger Jahre inspirierte die Kontroverse über Martin Heideggers Verhältnis zum Nationalsozialismus zahlreiche Untersuchungen, die sich der bis dahin gänzlich vernachlässigten Geschichte der Philosophie im Dritten Reich zuwandten. Diese bis heute anhaltende, auch durch den allgemeinen Aufschwung der Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte belebte Forschungskonjunktur förderte zahlreiche Studien zur Geschichte philosophischer Seminare zutage, zu Subdisziplinen wie der Philosophischen Anthropologie, vor allem aber zur intellektuellen Biographie repräsentativer Denker wie Heidegger, Jaspers, Scheler, Hartmann, Gehlen, Freyer, oder Cassirer, Plessner und Hönigswald, den Protagonisten der deutschen Philosophie in der Emigration. Es fehlte jedoch an einer als Gesamtdarstellung konzipierten Disziplingeschichte der Philosophie, die den zeithistorisch-politischen Verflechtungen des Faches institutionell, biographisch und ideengeschichtlich nachgespürt hätte, so wie dies die vorliegende Untersuchung tut. Erstmals wird hier die philosophiehistorischen Erforschung des Zeitraums zwischen 1918 und 1945 auf eine breite empirische Basis gestellt. Die ergibt sich aus der Berücksichtigung der akademischen Philosophie an dreiundzwanzig Universitäten sowie zehn Technischen Hochschulen des Deutschen Reiches, so daß die weltanschaulich-politischen Positionen von fast 400 Philosophiedozenten thematisiert werden, überwiegend jenen minores zweiten oder dritten Ranges, die bisher im Schatten der "Meisterdenker" vergessen wurden, deren Anteil am wissenschaftspolitischen Geschick ihre Faches jedoch kaum zu überschätzen ist.

Christian Tilitzkis gründliche Mammutstudie zur Universitätsphilosophie in der Nazizeit läutet ein neues Forschungsstadium ein und irritiert durch apologetische Töne
Hitler hielt nicht viel von deutschen Professoren. Wenn man ihnen die Welt überließe, meinte er, würden sie die Menschheit in lauter Kretins mit Riesenköpfen verwandeln. Hitler mußte seine Abneigung mäßigen, schließlich brauchte er Chemiker, Physiker, Biologen und Techniker. Auch Historiker und überhaupt Kulturwissenschaftler benötigte er, da der Nationalsozialismus eine Anzahl historischer Thesen voraussetzte. Da er überdies eine einheitliche deutsche Weltansicht bieten wollte, waren Philosophen gefragt, die allen Fachvertretern zu erklären hatten, was jetzt an der Zeit sei.
Dies war die Stunde derjenigen deutschen Denker, die schon länger mit dem "System" von Weimar gehadert und unter der Zerrissenheit des modernen Lebens gelitten hatten. Einige Philosophen hatten versucht, die Erfahrung des Weltkriegs zu durchdenken, sie hatten den Relativismus und Historismus "überwunden" und das Ende des Individualismus und Subjektivismus proklamiert; sie hatten das "Volk", die "Gemeinschaft" und die Gefährdetheit der Kultur entdeckt. Sie verkündeten nun, ein Zeitalter sei zu Ende gegangen; sie meldeten ihre Kompetenz an, die Gegenwart zu deuten und in die Zukunft zu weisen. Einige bildeten sich ein, sie könnten den Führer führen.
Der berühmteste dieser Weltweisen war Heidegger; seine Bekenntnisse zum Nationalsozialismus und seine Bemühungen, die Universität Freiburg, deren Rektor er 1933 wurde, nationalsozialistisch umzubauen, haben das Interesse von Historikern und Philosophen mehrfach auf sich gezogen, nachdem Habermas schon in den fünfziger Jahren in dieser Zeitung auf sie hingewiesen hatte. Auch andere bekannte Autoren wie Gehlen und Bäumler, Krieck oder Spranger wurden teils wegen ihrer "Verstrickung" angeklagt oder verteidigt. Eine flächendeckende Untersuchung der Universitätsphilosophie gab es nicht. Diese Lücke füllt nun das monumentale Werk von Christian Tilitzki. Er widmet sich den mittleren und kleinen Geistern; er registriert mit Akribie die philosophisch-politischen Positionen der Ordinarien und der Dozenten in allen philosophischen Seminarien der deutschen Universitäten. Für die Zeit nach 1938 bezieht er auch Österreich und Prag in seine Untersuchung ein. Unter der richtigen Voraussetzung, eine historische Untersuchung könne nicht erst mit 1933 einsetzen, sondern müsse von der intellektuellen Situation der Weimarer Zeit ausgehen, hat Christian Tilitzki die erste umfassende Geschichte der deutschen Philosophie von 1919 bis 1945 geschrieben.
Es gab Vorarbeiten für verwandte Disziplinen und biographische Studien zu einzelnen Autoren; es gibt die bedeutenden Arbeiten von Helmut Heiber über Walter Frank (bereits 1966 mit erheblicher Aktenkenntnis) und dessen Bände über die Universität unter dem Hakenkreuz. Tilitzki hat die vorliegende Literatur minutiös aufgearbeitet; sein Werk eröffnet ein neues Stadium der Forschung und Darstellung. Auch wer die Akzente anders setzt, muß in Zukunft von diesem Standardwerk ausgehen.
Die Darstellung gibt sich betont nüchtern. Sie beruht auf hervorragender Kenntnis der philosophischen Bücher dieses Zeitabschnitts; sie überrascht durch die Vielzahl wichtiger Dokumente, die bislang ungenutzt in Archiven gelegen haben. Sie erstaunt auch durch die Mitteilung, daß eine Reihe von Archiven immer noch die Benutzung ihrer Bestände verweigerten.
Verachtung in barschem Ton
Das Buch geht professionell historisch vor; es respektiert strikt die Chronologie und untersucht Berufungen und Habilitationen jeweils in den Zeitabschnitten 1919 bis 1924, 1925 bis 1932, 1933 bis 1939, 1939 bis 1945. Mit einer ungeheuren Fülle neuen Materials berichtet es über die Universitätspolitik und über Kommentare der Universitätsphilosophen zum politischen Zeitgeschehen. Der Band bringt ein Verzeichnis der politisch-weltanschaulichen Lehrveranstaltungen zwischen dem Wintersemester 1918/19 und dem Sommersemester 1945; es endet mit einem abundanten Verzeichnis der Quellen und der Literatur.
Was Tilitzki vorlegt, ist eine ausgezeichnete Geschichte der philosophischen Institutionen und der politischen Publizistik der Philosophieprofessoren. Eine Geschichte des philosophischen Denkens soll es offenbar nicht sein. Der Autor verkündet im barschen Ton seine Verachtung für die Moralisierung und Pädagogisierung der Zeitgeschichte; er vermeidet die überschwenglichen Tiraden früherer Geisteswissenschaftler; unwirsch polemisiert er gegen neueste Darstellungen, die zu generalisierenden Verdächtigungen neigen oder wohlfeilen verspäteten Widerstand gegen das nationalsozialistische Unrecht demonstrieren. Er plädiert für konsequente Historisierung. Sorgfältig bedient er seine Lieblingsfeinde, vor allem Wolfgang F. Haug und George Leaman.
Tilitzki zeichnet mit aktenmäßiger Trockenheit ein Kolossalgemälde, das sich nicht auf wenige Linien zusammenziehen läßt. Sein durchgehendes Interesse gilt der Vielfalt der Ansätze; überall sucht er Differenzierung und widerspricht einfachen Herleitungen. Insbesondere wendet er sich gegen die Vorstellung, die "Konservativen" der Weimarer Zeit seien Vorläufer des Nationalsozialismus gewesen. Er behauptet, selbst die Deutschnational-Völkischen wie Bruno Bauch, Max Wundt und Theodor Haering seien es nur bedingt gewesen. Die NSDAP und ihre Vordenker haben versucht, die Völkischen und die Rassentheoretiker der Weimarer Zeit zu absorbieren. Die "Wegbereiter" wurden zur Seite geschoben, als die Marschierer kamen. Also keine direkte Filiation und schon gar keine bleibende Harmonie zwischen den National-Konservativen und Hitler.
In diesem Zusammenhang skizziert Tilitzki instruktiv die Geschichte der Blätter für deutsche Philosophie und ihr Geschick in der Zeit des Nationalsozialismus. Auch für die Zeit von 1933 bis 1945 entdeckt der Verfasser eine Vielzahl von Ansätzen. Zwar seien Juden und Sozialisten vertrieben, Liberale und Zentrumsphilosophen zurückgedrängt gewesen, aber der Polyzentrismus der NS-Macht habe in der kurzen Zeit von 1933 bis 1939 nicht jeden Pluralismus beseitigen können. Dazu gab es zu viele Konflikte zwischen den Fakultäten, dem Ministerium und den verschiedenen Instanzen der Partei. Zwar habe die NS-Ideologie bestimmte gemeinsame Grundzüge gehabt: das Führerprinzip, Antiliberalismus, Antibolschewismus und Antisemitismus - aber jeder Philosoph, der die nationalsozialistische Weltanschaung kohärent darstellen wollte, wurde in Polemiken verwickelt. Es gab frühe Enttäuschungen, weil die nationalsozialistische Politik anders ausfiel, als mancher Befürworter Hitlers 1933 gedacht hatte. Der Führer ließ sich von deutschen Professoren nicht so recht führen.
Außerdem gab es immer noch berühmte Gelehrte wie Nicolai Hartmann oder Eduard Spranger, die zwar oberflächliche Kompromisse schlossen, aber ihrem "bürgerlichen" Wissenschaftskonzept mehr oder minder auffällig folgten. Die Macht der "Mandarine" ließ sich so schnell nicht brechen. Sie waren untereinander selten einig; auch der mächtige Alfred Bäumler konnte eine Habilitation über Platon nicht durchsetzen, wenn die Berliner Ordinarien philologische Mängel aufdeckten. Der Kriegsausbruch 1939 löste nicht entfernt die intellektuelle Aktivität aus, die 1914/15 zu beobachten war. Die Philosophie spielte nicht mehr die große Rolle von damals. Es war zu einem Abbau der Stellen und des öffentlichen Prestiges gekommen. Im Universitätsalltag litt die Philosophie unter dem überwiegenden Interesse, das Regierung und Partei an verwertbaren Wissenschaften zeigten. Auch die Pädagogik setzte sich oft als Konkurrenz durch.
Das Buch tritt mit fast positivistischem Pathos als historisch-empirisch auf. Es kondensiert eine Fülle neuen historischen Stoffs. Es bricht überzeugend die Wand ein, die zwischen Historikern und Philosophiehistorikern in Deutschland oft noch besteht und die dazu führt, daß dieselben Themen immer wieder mit dem Pathos der Identifikation behandelt werden und wichtige Quellen unbeachtet bleiben. Kenntnisreich beleuchtet es zeitgeschichtliche Bezüge einzelner theoretischer Positionen. Es versteht philosophiehistorische Forschung nicht als den hingebungsvollen Nachvollzug der inneren Logik philosophischer Positionen, sondern als die Analyse denkender Antworten auf präzis erforschbare geschichtliche Situationen. Es handelt sich um eine Berliner Dissertation, die Karlfried Gründer und Ernst Nolte begutachtet haben. Deren Einfluß ist präsent, besonders wenn immer wieder einmal an den "Weltbürgerkrieg" als Voraussetzung aller Denkarbeit erinnert wird, aber es handelt sich um keine Anfängerarbeit, sondern um eine methodisch durchreflektierte Mammutstudie, der eine klar bezeichnete politisch-philosophische Position zugrunde liegt. Diese provoziert Einwände. Fortschritte in stofflicher Hinsicht sind zu bewundern, aber die methodischen Grenzen dieser Art von Historiographie zu übersehen.
Der Krieg fiel vom Himmel
Tilitzki nimmt theoretische Positionen überwiegend, oft ausschließlich als Merkmale einer Gruppenzugehörigkeit. Er teilt die deutschen Denker nach "Lagern" ein, wie es die Geheimpolizei der NS-Zeit getan hat: Liberale, Sozialliberale, Sozialidealisten, Zentrumsphilosophen, Deutschnationale und völkische Rechte. Zuweilen kommen ihm Bedenken bei diesem Verfahren; dann macht er sich auf die Suche nach Differenzen und setzt die Worte "Lager" oder "Zentrumsphilosophen" in Anführungszeichen, aber das ändert nichts an der Einteilungssucht und an der Beschränkung des Blicks auf die Funktionen einer Theorie. Schließlich verschwinden die Anführungszeichen wieder, und es wimmelt von "Lager"- und Militär-Metaphern. Der Verfasser nennt sein Vorgehen eine "Musterung"; er findet die Philosophen in einer "Schlachtordnung". Er schreibt eine Geschichte der Philosophie, ohne sich für das Denken als Denken zu interessieren.
Das Buch zeigt: Die deutsche Philosophie hat einen "Wirrwarr von Werten und Worten" (J.F. Brecht) produziert. Tilitzki führt sie vor, um zu beweisen, daß es 1933 bis 1945 keinen Einheitsblock des Denkens gegeben hat. Um der Fülle des Materials irgend Herr zu werden, hilft er sich mit einer einfachen Abstraktion. Er konstruiert einen durchgehenden Gegensatz von völkisch-nationalsozialistischem Partikularismus und westlichem Universalismus. Humanisten, Liberale und katholische Philosophen steckt er ins "Lager" der "Universalisten". Er fordert historisch vorurteilsloses Verständnis für die Verteidiger des "Partikularismus", weil dessen Vordenker lokale und nationale Differenzen durch internationale Wirtschaftsverflechtung und universalistische Ideologien bedroht gesehen hätten. Der Nationalsozialismus als "Verteidiger der Partikularität", diese philosophasternde Umschreibung läßt das historische Phänomen hinter einer terminologischen Nebelwand verschwinden. Sie klingt, als sei die SA eine oberbayerische Trachtengruppe gewesen.
Überdies weist Tilitzki selbst nach, daß die Gedankenkonstruktion des Gegensatzes von Universalismus und "Partikularität" dem Gedankenvorrat nationalsozialistischer Professoren entstammt. Nun gehört es zu den Regeln historischer Arbeit, das Selbstverständnis früherer Philosophen sorgfältig zu erheben, aber nicht als Maßstab ihrer Bewertung zu übernehmen. Das Pathos historisch bewußter Strenge, das Tilitzki durchweg hervorkehrt, schlägt um in Apologie. Er versucht, das Bedrohtsein der "Partikularität" - wohlgemerkt: da ist vom hochgerüsteten Dritten Reich, nicht vom Regensburger Altertumsverein die Rede - mit der Zusatzhypothese zu beweisen, der Erste Weltkrieg sei gewiß nicht und der Zweite Weltkrieg sei wohl auch nicht primär das Ergebnis der deutschen Politik gewesen.
In diplomatisch verklausulierten Wendungen und mit Wahrscheinlichkeitsvorbehalten kündigt Tilitzki mit Berufung auf den Nichthistoriker Bernard Willms den Konsens auf, daß das Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Mit Hinweis auf noch nicht veröffentlichte Akten der Alliierten legt er die Vermutung nahe, die Rede von Deutschlands "Alleinschuld" sei politische Dogmatisierung. Wenn "Alleinschuld" bedeuten sollte, Hitler habe ohne Vorgeschichte im luftleeren Raum agiert, dann hätte Tilitzki freilich recht. Eine solche moralistische Abstraktion mag in der politischen Rhetorik zuweilen vorgekommen sein, aber die Bekämpfung dieses Phantoms setzt Tilitzkis Unternehmen dem Verdacht aus, er habe seinen politischen Dogmatismus mit mikrologischer Mimikry verdeckt.
KURT FLASCH
Christian Tilitzki: "Philosophie und Politik". Die deutsche Universitätsphilosophie in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. 2 Teilbände. Akademie Verlag, Berlin 2002. 1475 S., geb., 165,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Christian Tilitzkis monumentaler Versuch, die Geschichte der deutschen Universitätsphilosophie in Weimarer Republik und Drittem Reich zu schreiben / Von Frank-Rutger Hausmann
Christian Tilitzki hält mit seiner 1998/99 in Berlin eingereichten und von Karlfried Gründer (Philosophiegeschichte) und Ernst Nolte (Neuere und neueste Geschichte) betreuten Dissertation ein Scherbengericht über die jüngste Fachgeschichtsschreibung der Geisteswissenschaften ab. Keine Disziplin wird ausgespart, vor allem die jüngere Philosophiegeschichte nicht.
Gleich der Beginn seines Buches ist überspitzt sarkastisch. Zitiert wird ein SD-Bericht aus dem Jahr 1942 über den Zustand der damaligen Universitätsphilosophie. Aus ihm geht hervor, dass sich die ansonsten sehr gut orientierten Verfasser über die politische Einstellung ihrer Probanden nur in den seltensten Fällen im klaren waren. Tilitzki schreibt: „Wir begnügen uns mit diesem ersten Eindruck der anschaulichen Diskrepanz zwischen abstrakter Dürre ideologisch motivierter Klassifikation und konkreter Fülle wissenschaftshistorisch interessanter Realitäten. Denn bereits dieser erste Eindruck reicht hin, um die meisten der nach 1945 unternommenen Versuche, Relationen zwischen Philosophie und Politik nach 1918 wissenschaftshistorisch herzustellen, als Fortsetzung dieser nachrichtendienstlichen Bemühungen, als Feinderkundungen zu begreifen. Freilich bleiben diese neuen Versuche regelmäßig hinter den Leistungen des SD zurück, da man Schematisierungen auf wesentlich schmalerer Faktenbasis vornimmt und das reiche Spektrum politischer Einstellungen auf den Dualismus von fortschrittlich und reaktionär reduziert.”
Christian Tilitzkis Geschichte der Philosophie in Deutschland von 1918 bis 1945 gehört zu den Büchern, die lange vor ihrem Erscheinen zum Gerücht wenn nicht zur Legende geworden sind. Man wusste, dass hier ein dringend erwartetes Kapitel deutscher Philosophiegeschichte im Entstehen war; man meinte aber auch zu wissen, wes Geistes Kind der Autor war. Jetzt ist Gelegenheit, die Probe aufs Gerücht zu machen: In dieser Woche kommt Tilitzkis Werk in die Buchhandlungen. Wir baten den besten Kenner der Geschichte der Geisteswissenschaften im „Dritten Reich”, Frank-Rutger Hausmann, um sein Urteil.
SZ
Tilitzki wirft den Arbeiten, die nach 1990 erschienen, als die Archive der ehemaligen DDR und des Berlin Document Centre allgemein zugänglich wurden, im wesentlichen zwei Dinge vor: handwerkliche Fehler und Nachlässigkeiten bei der Recherche sowie unangemessenes Moralisieren. Der Autor geht Polemik nicht aus dem Weg, ja er sucht sie geradezu. Dabei vergisst er, dass jeder Forscher immer auch ein Zwerg auf den Schultern von Riesen ist. Man sollte sich jedoch nur bedingt auf seine Polemik einlassen, vielmehr kühl seine Argumente abwägen. Denn die Sache, um die es letztlich geht, ist von zentraler Bedeutung, vor allem zu einem Zeitpunkt, an dem in Deutschland die lange vorherrschende Scheu vor einer Kritik Israels und „der Juden” im Schwinden begriffen ist. Da ist es wichtig, sich die grundlegende hermeneutische Frage zu stellen, ob Fachgeschichte wirklich allein im Hinblick auf den Kenntnisstand und das politische Wollen der Akteure geschrieben werden kann, oder ob nicht stets das Wissen der Nachgeborenen um die in deutschem Namen begangenen NS-Verbrechen mit in Betracht gezogen werden muss.
Eine solche Haltung, die genau zwischen Bericht und Wertung trennt, sollte nicht, wie Tilitzki dies tut, als Moralisieren abgetan werden, denn sie will zugleich ein mitverantwortliches Denken und Schreiben benennen, dessen Folgen bereits damals im Ansatz erkennbar waren. Auch wenn derartige Äußerungen nicht unmittelbar kausal für Verbrechen waren, waren sie doch Teil eines intellektuellen Gesamtklimas, das abweichenden Meinungen brachial zu Leibe rückte.
Bekennender Revisionist
Tilitzki hat eine vollständige und lückenlose Darstellung der philosophischen Berufungsgeschichte von 1918 bis 1945 vorgelegt, die durch Vorlesungesverzeichnisse und Publikationen ergänzt wird. Seine akribische und geduldige Aktenauswertung ist eindrucksvoll, sachkundig und informativ. Über zweihundert Berufungen und Habilitationen, die entlang eines chronologischen und topographischen Gerüsts aufbereitet werden, decken die damalige Universitätslandschaft ab. An diesen Teilen der Untersuchung wird man in Zukunft nicht mehr vorbeigehen können. Sie liefern ein unerschöpfliches bio- bibliographisches Repertorium der philosophischen Fachvertreter im deutschen Sprachraum und erschließen gleichzeitig verwandte Bereiche (Religionsphilosophie, Staats- und Völkerrecht, Ökonomie, Rassenkunde usw.). Doch nicht nur das; selbst der Spezialist wird viel Neues finden und mit einer philosophischen Meinungsvielfalt konfrontiert, die nachzuzeichnen äußerst verdienstvoll und nachzulesen äußerst spannend ist.
Unter den zahlreichen Gelehrten, deren akademisches Schicksal berichtet wird, finden sich herausragende Namen, aus deren Phalanx exemplarisch Eduard Spranger, Edmund Husserl, Max Scheler, Hans Freyer, Karl Jaspers, Theodor Litt, Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Erich Rothacker, Arnold Gehlen, Hans-Georg Gadamer, Helmut Schelsky und Wilhelm Weischedel genannt seien. Nach Wesen und Verlautbarungen handelt es sich um ganz unterschiedliche Charaktere, deren spezifische Denkansätze deutlich aufscheinen.
Problematisch ist jedoch Tilitzkis zweiter Kritikpunkt: Auf den Spuren Noltes tritt er als Revisionist an, und er sagt dies explizit. Dort wo die Philosophie als „Repräsentant oder Opponent des Zeitgeistes” aufs engste mit politischem Tagesgeschehen verklammert sei, müsse, wer die Quellen rekontextualisieren und die Perspektive der Zeitgenossenschaft gewinnen wolle, „vielfach revisionistische Bereitschaft zeigen, um die Quellen auch gegen ideologisch durchsetzte zeitgeschichtliche Auffassungen des Kontextes zu interpretieren”.
Deshalb hält der Autor die in den meisten fachgeschichtlichen Darstellungen vorherrschende Konzentration auf den Zeitraum 1933 bis 1945 für unangemessen. Er bestreitet, dass in dieser Periode der Zusammenhang zwischen Politik und Forschung enger gewesen sei als davor oder danach. Wer den Professoren ideologische Verblendung vorwerfe, sei nicht nur ein Opfer der alliierten Umerziehungspolitik nach 1945, sondern übersehe die Gründe, die es für Antibolschewismus, Antisemitismus und vor allem Antiamerikanismus nach 1918 gegeben habe. Im übrigen sei auch die Hochschulpolitik der Weimarer Republik unter den sozialdemokratischen oder doch mit der SPD zusammenarbeitenden Ministern Carl Heinrich Becker und Adolf Grimme eindeutig politisiert gewesen. Die immer wieder zu lesende Behauptung, die Weimarer Professorenschaft sei konservativ und rechtslastig gewesen, wird durch Tilitzkis Nachweise der vielfältigen parteipolitischen Bindungen der Philosophen in der Tat widerlegt.
Dieser Befund lasse es, so der Autor weiter, als dringend geboten erscheinen, die Weimarer Republik in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung nicht länger als Übergangsperiode zwischen Kaiserreich und „Drittem Reich” zu betrachten, sondern in ihre autonomen Rechte einzusetzen. Diese Forderung ist nicht neu, doch Tilitzki entwirft für die Zeit nach 1933 nicht nur das Bild einer letztlich gescheiterten Gleichschaltung, sondern attestiert dem überwiegenden Teil der Philosophieprofessoren Distanz zum Regime und Gleichgültigkeit gegenüber seinen Parolen. Eine systematische Auseinandersetzung mit wichtigen Kernbegriffen wie Rasse, Volk, Reich, Führer oder Krieg sei nicht erfolgt.
Die totalitäre Versuchung
Um seine Darlegungen unangreifbar zu machen, hat Tilitzki für seine Kollektivbiografie die doppelte Aktenführung der Kultusministerien des Reichs und der Länder sowie der Universitäten ausgewertet, soweit sie Berufungen und Habilitationen von Philosophen illustriert. Der völkisch- rassische Schwenk deutscher Philosophen (und der Vertreter anderer Disziplinen) nach 1933 wird zwar nicht geleugnet, jedoch nur verklausuliert benannt und relativiert.Zwar stellt auch Tilitzki vor und nach 1933 Affinitäten zu totalitären Utopien fest, einen Hang zur Verneinung moderner „Entzweiungen”, doch müsse diese „totalitäre Versuchung” stets auf das aus zeitgenössischer Sicht „mit guten Gründen abgelehnte ,Liberale System‘ der Moderne” bezogen bleiben. Was damit gemeint ist, lässt sich nur vermuten: die Weimarer Demokratie, die zu ständig wechselnden Regierungen führte, keinen starken Staat hervorbrachte und somit die Folgen von Versailles nur mangelhaft parierte?
Doch die Wurzeln des angesprochenen Utopismus reichen, was Tilitzki nicht sagt, bis tief in die Anfangszeit der Humboldtschen Universität und der dort gepflegten Geisteswissenschaften hinab. Ihre Adepten gaben sich objektiv, was in Zeiten von Textphilologie und junggrammatisch betriebener Sprach geschichte noch plausibel scheinen mochte. Sie übersahen nur, dass bereits die Wahl des Gegenstandes ein Politikum darstellt.
Wer beispielsweise von germanischem Superstrat sprach und den Volksgeist verherrlichte, argumentierte antagonistisch. Er konnte einhundert Jahre später für ganz andere Zwecke vereinnahmt werden. Auch die Vorstellung, dass der deutsche Geist in besonderem Maße zu philosophischer Spekulation begabt und die deutsche Kultur derjenigen anderer Völker überlegen sei, sollte sich als verhängnisvoll erweisen. Aggression und Revanchismus hatten es, je nach politischer Großwetterlage, leicht, ihr Ideenpotential geisteswissenschaftlich zu untermauern und argumentativ anzureichern.
Eine Immunisierung gegen derartigen Missbrauch hätte allein durch Rückkopplung der Forschung an die Standards der internationalen scientific community sowie durch ihre Einbindung in das Netzwerk ausländischer Kritik gewährleistet werden können. Nicht jedoch durch konkurrentielles Denken und Abgrenzung nach außen bei gleichzeitiger Favorisierung des deutschen Sonderwegs.
Ein weiterer Vorbehalt muss gegen die Aussagekraft des von Tilitzki beigezogenen Aktenmaterials gemacht werden. Es handelt sich in erster Linie um Berufungsakten, was zunächst eine Perspektivenverschiebung von den Individuen hin zu den Institutionen bedeutet. Diese wird durch sogenannte Kommentare zum Zeitgeschehen, direkte Meinungsäußerungen der erwähnten Philosophen, nur ein Stück weit aufgefangen.
Wer je in einer Kommission mitgewirkt hat, weiß, dass ihre Mitglieder zwar vorgeben, den Besten zu berufen und ihre Wahl entsprechend begründen, dass aber vielfach außerwissenschaftliche Argumente für ihre Entscheidungen maßgeblich sind. Da sie für sich exklusiv den notwendigen Sachverstand reklamieren und die akademischen Gremien wie auch die mit der Sache befassten Behörden meist nur die Form prüfen, verschleiern Gutachten mehr, als dass sie offen legen. Sie sind zudem, einmal unterzeichnet, keiner Revision mehr zugänglich.
Da in politisch angespannten Zeiten ein instinktiver Vorsicht entspringendes „verba volant, scripta manent” gilt, könnten am ehesten Zeugnisse über die akademische Lehre wie die aktive Mitwirkung in Parteien und ihren Unterorganisationen Auskunft über die wahren Meinungen und das tatsächliche Verhalten von Hochschullehrern geben, doch diese fehlen so gut wie ganz. Dass bloße Parteimitgliedschaft wenig aussagekräftig ist, hat sich längst herumgesprochen.
Es führt noch aus einem anderen Grund kein Weg daran vorbei, dass „Auschwitz” auch weiterhin Dreh- und Angelpunkt der Erforschung der jüngeren Fachgeschichte bleiben muss. Dafür spricht nicht nur, dass die bis zur sogenannten Machtergreifung auch von völkisch gesonnenen Professoren respektierten international üblichen Kategorien der Wissenschaftlichkeit (Objektivität und Vorurteilslosigkeit bei der Gewinnung der Ergebnisse, Überprüfbarkeit nach allgemeingültigen Standards, Gleichwertigkeit der Forscher ohne Ansehen von Rasse, Konfession und Nationalität usw.) bereits vorher ausgehöhlt worden waren, aber erst danach außer Kraft gesetzt wurden.
An die Stelle der Philosophie sollte eine „Deutsche” Philosophie treten, das heißt, eine Philosophie auf völkisch-rassischer Grundlage für Deutsche und bestenfalls für „Artverwandte”. So etwas hat es weder vor- noch nachher gegeben. Selbst im Stalinismus hatte, wer sich auf ihn berief, Chancen, auf dieser Basis unbehelligt Wissenschaft betreiben zu können. Ein „Jude” konnte sich nicht zum Nationalsozialismus bekennen, er war im Prinzip des Todes. Sicher, Versailles hatte neues Unrecht gestiftet und für Revisionsforderungen gesorgt, die nach damaliger Rechtslage verständlich waren. In einem demokratisch gefestigten Gemeinwesen hätten diese nicht zu Extremismus führen müssen; es hätte selbst offenen Antisemitismus verkraftet.
Aber es macht einen großen Unterschied, ob, wie im NS-Staat geschehen, Antisemitismus, Antibolschewismus und Antiamerikanismus zu Ideologemen eines ungebremsten Führerstaates wurden oder Privatmeinungen blieben. Selbst wenn eine sich lähmende Polykratie nicht besonders zielorientiert vorging und die geistige Dürftigkeit der nationalsozialistischen Ideologie unübersehbar war, wäre dieser Prozess der Umgestaltung der Philosophie wie der anderen Disziplinen bei Fortbestand des NS-Staates nicht aufzuhalten gewesen.
Volkssturm am Katheder
Tilitzkis Buch bricht, nachdem die chronologische Grenze von 1945 erreicht ist, etwas unvermutet ab. Der Leser hätte eine gründlichere Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse dieser flächendeckenden Recherchen erwarten können. Doch der Autor überlässt es ihm, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Zahl der nationalsozialistischen Hardliner hat sich in Tilitzkis Darstellung letztlich auf Alfred Baeumler, Ernst Krieck und einige Minores reduziert, und dies soll offenkundig besagen, dass es keine kohärente NS-Philosophie gegeben hat.
Dieses Ergebnis war bereits am Ende der Einleitung angedeutet worden und wurde von verständigen Fachhistorikern im übrigen nie bestritten. Denn die meisten gehen auch für die NS-Zeit schon seit langem zwar nicht von Pluralismus, so doch von geduldeter Mehrstimmigkeit der Meinungen aus. Sie ist die Folge einer missglückten Gleichschaltung im Hochschulbereich, nicht das Ergebnis von Toleranz.
Dabei darf nicht übersehen werden, dass sich die Zeitspanne eines „beruhigten” Universitätsbetriebs unter NS-Bedingungen auf die Jahre 1935 bis 1940 reduziert. Unmittelbar nach Kriegsbeginn musste sich der soeben erst in Lagern und Gemeinschaftsprojekten geschulte NS-konforme wissenschaftliche Nachwuchs an der Front „bewähren” und trat nur noch selten ans Katheder. Mangels Alternative wurden die Alten reaktiviert und einige Frauen aus dem Abseits geholt, um die so gerissenen Lücken zu füllen. Doch es hat wohl kaum Zweck, mit Tilitzki über diese Entwicklung zu argumentieren, da er der Meinung ist, die NS-Zeit sei eine Periode der deutschen Geschichte wie andere auch.
Bleibt abschließend anzumerken, dass auch die philosophische Hochschullehrerschaft infolge der NS-Beamten- und Rassengesetze von 1933 bis 1935 einen maßgeblichen Teil ihrer angesehensten Mitglieder verlor – man denke an Cassirer, Hönigswald, Löwith, Plessner, Kroner undandere –, ein Vorgang, der von den Nichtbetroffenen kommentarlos bis zustimmend hingenommen wurde.
Gehörte nicht auch damals das Teilgebiet Ethik als Lehre des sittlichen Handelns zum Kernbestand der Philosophie? Da sich der Autor jedoch nach seinen eigenen Worten von der verbreiteten Praxis, „Wissenschaftsgeschichte mit ideologisierten Konstrukten der jüngeren deutschen Geschichte kurzzuschließen”, abkehren möchte, könnte vermutlich auch diese Feststellung an seinem Gesamturteil nichts ändern. Man kann Tilitzki in diesem Punkt keinesfalls zustimmen; dennoch wird man einen nicht unerheblichen Erkenntnisgewinn aus seinem Buch ziehen.
CHRISTIAN TILITZKI: Die deutsche Universitätsphilosophie in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, 2 Teile. Akademie Verlag, Berlin 2002. 1473 Seiten, 165 Euro.
Gestalten der deutschen Universitätsphilosophie zwischen Erstem Weltkrieg und Drittem Reich. Von links oben nach rechts unten: Hugo Dingler (7.7.1881 – 29.6.1954). Martin Heidegger (26.9.1889 – 26.5.1976). Max Scheler (22.8.1874 – 19.5.1928). Hans Freyer (31.7.1887 – 18.1.1969). Arnold Gehlen (29.1.1904 – 30.1.1976). Wilhelm Weischedel (11.4.1905 – 20.8.1975). Joachim Ritter (3.4.1903 – 3.8.1974). Karl Jaspers (23.2.1883 – 26.2.1969).
Fotos: Ullstein / S.M. / Interpress / dpa / dpa
Ullstein-Berlin / F. Eschen, Ullstein / Scherl
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Starkes Buch. 1475 Seiten stark. Und eine "scharfe Anklage" gegen die bisherige philosophiehistorische Forschung in Sachen Nationalsozialismus. Er kenne, schreibt Thomas Meyer in einem höchst gekonnten Verriss, keine Studie, die das Wissen um die deutsche Philosophie zwischen 1918 und 1945 auch nur in Ansätzen "derart erweitert und kontextualisiert" wie die vorliegende. Großes Lob also für den "Aktenkenner" und "Quellenpositivsten" Tilitzki. So weit, so gut. Was folgt, ist eine gnadenlose Abrechnung mit einer sich auf Theoreme Ernst Noltes stützenden Dissertation, die nicht nur "von Beginn an jede Form historischer Objektivität verfehlt" und jegliches Interesse an den politischen Vorgängen des "Dritten Reiches" vermissen lässt, sondern darüber hinaus - und das ist ein Vorwurf, über dessen Brisanz "in diesen Wochen" sich der Rezensent durchaus im Klaren ist - "Merkmale jenes intellektuellen Antisemitismus" aufweist, "der jüdische Denker nur als abstrakte denunziert und ihre universalistische Ethik als leere Formen". Starker Tobak. Aber Meyer nennt Beispiele, die seinen Vorwurf stützen sollen: Keine Zeile etwa finde sich über die Spinoza-Publikationen von Leo Baeck, Leo Strauss u.a. aus der Weimarer Zeit, während der Spinoza-Streit des "Dritten Reiches" in "jeder Nuance" verhandelt werde; Einrichtungen wie das Frankfurter Lehrhaus von Franz Rosenzweig oder das jüdisch- Theologische Seminar in Breslau seien für den Autor nicht existent. Die Kritik an diesem Buch, so Meyer abschließend, müsse an der Methode und an der Interpretation ansetzen, "die zahllosen Ungeheuerlichkeiten" als Teil der Textstrategie verstanden werden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH