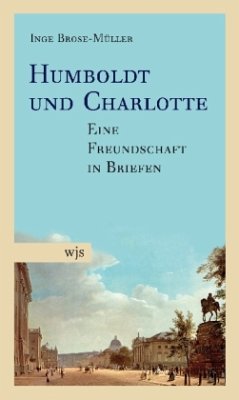In einfühlsamer Beschreibung einer Freundschaft stellt die Humboldt-Kennerin Inge Brose-Müller ein Verhältnis besonderer Art dar: Als die Pfarrerstochter Charlotte Diede infolge der Napoleonischen Kriege ihr gesamtes Vermögen verliert, wendet sie sich Rat suchend an Wilhelm von Humboldt, dem sie in ihrer Jugend persönlich begegnet ist. Er unterstützt sie und bleibt mit ihr bis zu seinem Tod in Briefen verbunden, die der unglücklichen Charlotte Lebenselixier werden, die aber auch für Humboldt von großer Wichtigkeit sind. Er gibt darin nicht nur viel von seiner Persönlichkeit und seiner Ideenwelt preis, sondern formuliert seine Gedanken derart, dass sie der Freundin und damit auch dem Leser von heute verständlich werden. Die später unter dem Titel »Briefe an eine Freundin« veröffentlichten Texte gehören noch immer zu den bedeutendsten Zeugnissen der deutschen Briefliteratur. Auf sehr persönliche Weise schildert die Autorin das Verhältnis zwischen Humboldt und Charlotte, beleuchtet den zeit- und kulturgeschichtlichen Hintergrund der Epoche und versucht, »das männliche und das weibliche Prinzip« in Humboldts Schriften mit den Ideen seiner Zeitgenossen zu verbinden. Sie spürt der Herkunft des »Wahren, Guten, Schönen« nach, das Humboldt und Charlotte von Jugend an begeistert hat, und sie greift die Italiensehnsucht der Klassik in der dichterischen Spannung zwischen Norden und Süden auf. Das Buch öffnet nicht nur den Blick auf Humboldts Gedankenwelt in seiner Zeit, es schildert zugleich das Dasein einer bürgerlichen Frau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Humboldt musste zurück auf seine Universität Göttingen, versprach aber baldiges Wiedersehen. Doch wenige Wochen danach lernte er seine spätere Frau Caroline von Dacheröden kennen, mit der er dann jene dreißig Jahre währende, in sieben Briefbänden dokumentierte freizügige moderne Musterehe führte, die die Nachwelt bis heute bewundert.
Charlotte, die Sommerliebschaft von 1788, vergaß er trotzdem nicht. Als Humboldt 1814 als Bevollmächtigter Preußens beim Wiener Kongress weilte, erreichte ihn ein Brief Charlottes, der an die gemeinsame Zeit 26 Jahre zuvor erinnerte und zum Beweis ein Stammbuchblatt von Humboldts Hand enthielt. Und Wilhelm von Humboldt, der inzwischen als Staatsmann und Gelehrter, als Freund Schillers und Goethes, als Bruder des Weltreisenden Alexander weltberühmte große Herr, reagierte ohne Säumen.
Denn Charlotte war in Not. Sie hatte wie manche andere Frauen der Zeit von Klassik und Romantik versucht, einen selbstbestimmten Lebensweg zu gehen. So schlug sie eine solide Ehepartie aus, ohne in der selbstgewählten Partnerschaft glücklich zu werden. Nach einer Scheidung zugunsten eines Liebhabers, der sie nach zehn Jahren sitzen ließ, stand sie mittellos da. Denn ihr kleines ererbtes Vermögen hatte sie 1806 in braunschweigischen Staatspapieren angelegt; doch dann ging das Herzogtum Braunschweig in der großen preußischen Niederlage unter, und die Anleihen wurden wertlos. Die geschiedene Pfarrerstochter musste versuchen, sich selbst zu unterhalten, für eine nicht mehr junge bürgerliche Frau dieser Epoche fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Sie erwarb sich ein Zubrot durch die Herstellung modischen Schmucks aus künstlichen Blumen in aufwendiger Handarbeit, immer im Wettlauf mit den Trends der Saison, die den Modejournalen entnommen werden mussten. Außerdem aber lebte sie seit 1814 von regelmäßigen Zuwendungen Humboldts, der seiner mittlerweile bei Kassel auf dem Lande wohnenden Freundin auf komplizierten Wegen, meist über Verlagshäuser, alle Vierteljahre nicht unbeträchtliche Summen zukommen ließ.
Humboldts Philanthropie war nicht ganz uneigennützig, sie war auch nicht aus purer Sentimentalität geboren. Er trat nun in einen zwanzigjährigen, bis zu seinem Tod 1835 währenden Briefwechsel mit Charlotte Diede ein, der ihm große Befriedigung gewährt haben muss. Er sorgte für eine wohl immer noch geliebte Frau, ohne sie näher an sich heranzulassen – Angebote Charlottes, als Hausdame in den Humboldtschen Haushalt einzutreten, lehnte er fast schroff ab, zwei persönliche Begegnungen 1819 und 1828 blieben ohne Folgen –, dafür ergriff er das Regiment über ihre Seele.
Sie musste ihm ihr Leben in allen Einzelheiten von Kindheit an aufschreiben, außerdem genauen Bericht von allen gegenwärtigen Lebensumständen und Seelenstimmungen geben, bis hin zu Details wie den Ausblicken aus den Fenstern, der Inneneinrichtung ihrer Wohnung, der Art der Tagesarbeit, geben. Er aber machte sie zum Gefäß seiner Lebensphilosophie, schrieb ihr lange Traktate zu Gott und Welt, Kosmos und Seele, über den sichersten Weg zur Zufriedenheit und zum seelischen Gleichgewicht. Dass dabei ein Hauch erotischer Bizarrerie mitschwang, die durchaus lustvoll erlebte Fernregierung über ein abhängiges, notleidendes, rührendes Wesen, dürfte sich Humboldt, der zu scharfer Selbstbeobachtung befähigt war, nicht verborgen haben.
Nach Charlottes Tod 1846 wurden die noch von ihr selbst bearbeiteten und gekürzten Briefe Humboldts – die Gegenbriefe der Frau blieben liegen und gingen verloren – publiziert und erfuhren einen beachtlichen literarischen Erfolg. Staunend erlebten die Zeitgenossen den sonst so trockenen, scharfsinnigen, im persönlichen Umgang sogar meist zynisch witzelnden Humboldt in einer ganz neuen Tonlage: als Weisen, als Lebenshelfer, der den empfindsamen Ton seiner Jugend mit der abgeklärten Ruhe einer goethisch anmutenden Altersmanier verband.
Dieser Erfolg setzte sich fort, als 1910 endlich eine kritische Gesamtausgabe dieser Briefe durch Albert Leitzmann vorgelegt wurde. Wer sich in dem etwas abstrakten Wohlklang ihrer Sprache zurechtfindet – und nicht, wie Varnhagen von Ense dort nur „weichliche Seelenbuhlerei, ein ewiges Beichten und Beichthören ohne Tatsachen, ein in aller Weltlichkeit bewahrtes Mönchtum“ findet – der wird mit einem sonderbaren Eindruck belohnt: einem Weisheitsbuch, das man gern zwischen „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ und den „Nachsommer“ rücken möchte.
Es konnte nicht ausbleiben, dass im Zuge der aktuellen umfassenden Humboldt-Renaissance nach seinem Ehebriefwechsel mit Caroline, den Hazel Rosenstrauch 2009 vorstellte, dem gebildeten Bürgertum nun auch die Charlotte-Briefe wieder nahegebracht werden. Wieder ist es eine Frau, die sich dieser Aufgabe mit Feingefühl und breitem Wissen widmet, die Frankfurter Pädagogin Inge Brose-Müller. Brose-Müller erzählt die Geschichte dieser Brieffreundschaft nicht rein chronologisch, sondern entwickelt den Inhalt der Humboldtschen Schreiben auch nach einzelnen Themen, die von den realen Lebensumständen – wie wohnte und lebte der Gelehrte, wie überwies er seine Geldzuwendungen an Charlotte – zu dessen Denken über Sterben, Tod und Unsterblichkeit reichen.
So bekommt man auf knappem Raum eine gründliche Essenz geboten, die aus einer langen Reihe vorzüglicher Zitate gewonnen wird. Als Einführung ist der schmale Band sehr zu empfehlen. Doch sollte man sich nicht darüber täuschen, dass er dem Leser das Beste dieser Briefe vorenthält, das nicht in der platonisch-christlichen Seelengenügsamkeit, der stillen Naturfreude und kosmischen Ruhe, die sie predigen, besteht, sondern in ihrer meditativ verlangsamten Sprache. Sie erlaubt es nur, die Briefe ganz allmählich, Stück für Stück zu lesen, so wie sie entstanden und wie sie aufgenommen wurden, über eine lange Zeit.
Erst dann entfalten sie beinahe magische Wirksamkeit und ihren erstaunlichen Binnenreichtum. Und so muss man es beklagen, dass derzeit keine handliche Ausgabe, und sei es in Auswahl, von diesen Texten greifbar ist. Dort könnte der Leser beispielsweise den einzigartig schönen Brief vom 12. September 1824 nachlesen, der zum Thema Tod Folgendes enthält:
„Diese Ansicht des Lebens als eines Ganzen, als einer zu durchmessenden Arbeit, hat mir immer ein mächtiges Mittel geschienen, dem Tode mit Gleichmut entgegenzugehen. Betrachtet man dagegen das Dasein nur stückweise, strebt man nur, einen fröhlichen Tag dem andern beizugesellen, als könne das nun in alle Ewigkeit hin fortgehen, so gibt es allerdings nichts Trostloseres, als an der Grenze zu stehen, wo der Faden auf einmal abgebrochen wird.“
Im selben Brief heißt es kurz danach: „Überhaupt liegt in den Bäumen ein unglaublicher Charakter der Sehnsucht, wenn sie so fest und beschränkt im Boden stehen und sich mit den Wipfeln, so weit sie können, über die Grenzen der Wurzeln hinausbewegen. Ich kenne nichts in der Natur, was so gemacht wäre, Symbol der Sehnsucht zu sein.“ So gehe es aber auch dem Menschen: „Er ist, wie weit er herumschweifen möge, doch auch an eine Spanne des Raumes gefesselt.“
Man sieht schon aus solchen Proben – Inge Brose-Müller enthält sie ihren Lesern nicht vor –, dass es sich um Äußerungen des Alters handelt, um ein Zurückblicken, Abschließen und Resümieren. Die Ergebenheit, mit der Humboldt seine Verluste, einschließlich des Todes seiner Frau, entgegennimmt, hat freilich manchmal etwas fast Verstörendes. Nicht jedem ist die Gabe des Gleichmuts so gegeben, aber keinem Zweiten eben auch nicht die, ihn so abwechslungsreich und scharfsinnig zu artikulieren. So bleiben diese Texte Zeugnisse einer bemerkenswerten Lebenskunst, vor allem in der Bewirtschaftung eines aus der Jugend ins Alter geretteten Gefühls.
Wer kurz hinter den Vorhang blicken möchte, kann sich an die ernüchternde Feststellung von Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt halten, in dessen Archiv die Briefe am Ende landeten: „Mein Bruder hätte der guten Diede weniger schreiben und mehr geben sollen.“
GUSTAV SEIBT
INGE BROSE-MÜLLER: Humboldt und Charlotte. Eine Freundschaft in Briefen. Wjs Verlag, Berlin 2010. 251 Seiten, 16,90 Euro.
Das Beste dieser Briefe
Humboldts liegt in ihrer
meditativ verlangsamten Sprache
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Gustav Seibt delektiert sich an einem Hauch erotischer Bizarrerie. Der entsteigt einem Buch von Inge Brose-Müller über die Brieffreundschaft zwischen Wilhelm von Humboldt und Charlotte Diede. Seibt schätzt die Entscheidung der Autorin, dem Leser die erhaltenen Humboldtschen Briefe nicht rein chronologisch, sondern auch nach Themen geordnet zu präsentieren, weil dadurch auf geringem Raum Essenzielles zusammenkommt. So gereicht der Band dem Rezensenten zur empfehlenswerten Einführungslektüre in die durchaus pikante Beziehung Humboldt/Diede, hier garniert mit nach Seibts Dafürhalten unbedingt langsam zu lesenden "vorzüglichen" Textproben der Humboldtschen Lebens-, Resümier- und Schreibkunst und mit "Feingefühl" und "breitem Wissen" erarbeitet von Inge Brose-Müller.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH