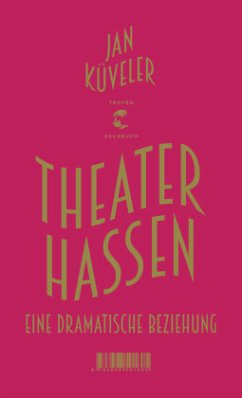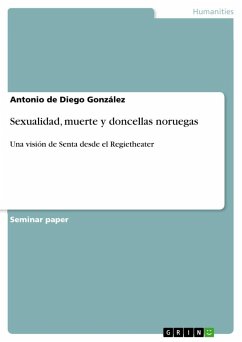Damit das Theater bleiben kann, was es war, muss es sich ändern. »Theater hassen« ist eine Streitschrift gegen und für das Theater, eine Totenrede und ein Liebesbrief, eben Ausdruck einer dramatischen Beziehung.
Fahle Gespenster schleichen über die Bretter, die früher die Welt bedeuteten, heute aber nur mehr morsch knarzen. Das Theater verrennt sich in einer Nische, die niemanden interessiert. Verzweifelt holt es Flüchtlinge auf die Bühne oder zwingt die Zuschauer zum Mitmachen. So verkommt es zum Kabarett und zum Kindergarten. Außerdem ist es enorm unpraktisch: abhängig von Subventionen, trotzdem teuer, unverwandt elitär, nur heuchlerischer als früher, unbequem - weder kann man Popcorn essen noch auf die Toilette gehen. Es gibt jede Menge Gründe, das Theater zu hassen. Man ist es ihm sogar schuldig, besonders, wenn man es liebt.
Fahle Gespenster schleichen über die Bretter, die früher die Welt bedeuteten, heute aber nur mehr morsch knarzen. Das Theater verrennt sich in einer Nische, die niemanden interessiert. Verzweifelt holt es Flüchtlinge auf die Bühne oder zwingt die Zuschauer zum Mitmachen. So verkommt es zum Kabarett und zum Kindergarten. Außerdem ist es enorm unpraktisch: abhängig von Subventionen, trotzdem teuer, unverwandt elitär, nur heuchlerischer als früher, unbequem - weder kann man Popcorn essen noch auf die Toilette gehen. Es gibt jede Menge Gründe, das Theater zu hassen. Man ist es ihm sogar schuldig, besonders, wenn man es liebt.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Katrin Bettina Müller durchschaut Jan Küveler und die Strategie des Theaterkritikers, der auch Pop sein möchte und dauernd nach großen Affekten sucht, um nicht der Langeweile anheimzufallen. Eigentlich böse, doch Müller verpackt das ganz nett und suggeriert Mitgefühl, wenn Küveler in den Texten Fußball, Netflix und Kino heranzieht, um über Katharsis zu schreiben oder seine Abneigung gegen den Konsens zu illustrieren. Küvelers Liebe zur Volksbühne ist wiederum ja auch beinahe Konsens, könnte man sagen. Aber Müller sagt das nicht, und entdeckt lieber die unterhaltsamen Seiten des Buches oder die lehrreichen, wo der Autor aus der Theatergeschichte erzählt. Das klingt mitunter wie schönstes Feuilleton zwischen einigem "Dramaturgen-Wortgeklingel", findet die Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

nma
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der Theaterkritiker Jan Küveler hat aufgeschrieben, warum er das Theater
hasst. Nein, nicht wirklich – eigentlich liebt er es ja, er ist nur oft genervt
VON CHRISTINE DÖSSEL
Wenn ein Theaterkritiker ein Buch schreibt mit dem Titel „Theater hassen“, ist das natürlich kokett, wenn nicht Etikettenschwindel. Jan Küveler, Theaterredakteur der Welt und Welt am Sonntag, führt denn auch in seiner gleichnamigen Streitschrift schon auf der Buchrückseite beschwichtigend an: „Wer das Theater liebt, darf das Theater hassen.“ Punkt. Damit das gleich mal geklärt ist. „Eine dramatische Beziehung“ heißt das Büchlein im Untertitel und verspricht damit ganz theatralisch: Drama, Baby!
Was nach Auslotung einer dunkel lockenden Hassliebeshölle klingt, nach den Höhen, Tiefen und Abhängigkeiten einer Double-Bind-Falle von womöglich Strindberg’schem Ausmaß, nach den Geständnissen und Bekenntnissen eines Leidenden, der an dem zugrunde geht, was er liebt und wofür er lebt (oder, na ja, zumindest arbeitet), ist letzten Endes dann aber nur ein solipsistischer Aufwasch. Statt Grundsatzkritik: Kritikergenörgel. Statt Liebe: Liebhaberei. Und der versprochene Hass äußert sich hauptsächlich auch nur im Genervtsein.
Dabei beginnt der Essay viel versprechend provokant und flamboyant. Küveler, Jahrgang 1979, stellt sich selbstbewusst auf die hohe Gesamtschauwarte und nimmt als jüngerer, betont popkulturell aufgestellter Kritiker das Theater schnell mal von seinen Anfängen bis heute ins Visier, da es „aus der Zeit gefallen“ zu sein scheint: „eine Wellness-Oase, in die die nivellierte Mittelschicht geht, wenn sie Heimweh hat nach dem 20. Jahrhundert“. Peng.
Der Autor switcht locker-flockig von Aristoteles („Ach, Katharsis“) über Shakespeare hin zum Berliner Theatertreffen („ein unglaublicher Proporzverein“), wo neuerdings „immersiv-hybrid-virtuell-montierte Community-Umstülpungen“ grassieren. So polemisiert Küveler keck vor sich hin – nicht, ohne auf den Unterschied zwischen Theater und Fußball oder Netflix-Serien zu rekurrieren und dann wieder zu Schiller zu springen („Theater als gesellschaftspolitische Anstalt“) und von dort ins 19. Jahrhundert, der großen Zeit der Bühne als Repräsentationsort des Bürgertums. Womit Küveler dann beim Wiener Burgtheater wäre, wo das Theater immer noch so sei wie anno dunnemals. Zumindest beschreibt er die Burg als einzige Klischee-Ansammlung, sichtet an der Garderobe haufenweise Pelze und Zylinder. „Selbst wenn man eben noch aus dem Taxi gestiegen ist, denkt man inzwischen, es wäre ein Fiaker gewesen.“ Ja, witzig schreiben kann er, der Kollege Küveler. Nur tut er dies gerne auch mal auf Kosten eines genaueren Blicks oder tieferer Einsichten.
Am Burgtheater war es auch, wo Küveler eine miserable „Antigone“ gesehen hat. Dass er detailliert beschreibt, warum er die Inszenierung „hassenswert schlecht“ fand und damit seine Maßstäbe darlegt, gehört zu den ergiebigen Passagen – ebenso wie die Umschreibungen jenes „Mehrwertes“, nach dem er im Theater sucht. Das, was Aristoteles „Katharsis“ nannte. Bei Küveler heißt das „Seelenorgasmus“ und hört sich so an: „Es ist ein bisschen wie Verliebtsein. Man ist bei sich, aber zugleich auch nicht. Man lernt sich selbst von einer anderen Seite kennen. Man denkt die ganze Zeit, genau genau genau oder ja ja ja.“
Man könnte dieses ersehnte „Mehr“ auch „erhebendes Kunsterleben“ nennen, aber das ist ein Begriff, für den sich Küveler eher geniert, wie offenbar generell für seinen Old-School-Beruf als Theaterkritiker. Weshalb er spürbar bemüht ist, möglichst cool rüberzukommen, was die Lektüre oft trübt, umso mehr, als sich der Band zunehmend in Redundanzen und im eng gesteckten Rahmen seiner Beispiele verheddert. Gegen ein „Gewurschtel“, wie er es der Gießener Schule und ihren Abkömmlingen vorwirft, ist auch Küveler nicht gefeit. Da ergeht er sich ellenlang in der sogenannten Spiralblock-Affäre, in deren Mittelpunkt 2006 der FAZ-Kritiker Gerhard Stadelmaier stand. Und er rollt noch einmal den Zoff um die (verhinderte) Uraufführung von Fassbinders Stück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ in Frankfurt auf – als Beispiele für den Mut bzw. die Feigheit von Theatern. So läuft der merklich aus Zeitungstexten zusammengeschusterte Essay immer wieder aus dem Ruder oder macht abenteuerliche Schleifen, um im Kern aufzulisten, was den Autor nervt. Nämlich: politisches Theater, Mitmachtheater, Performancetheater, Michael Thalheimers Theater, Falk Richters Theater (namentlich „Fear“) und vor allem – Küvelers Nervfigur Nummer eins – die „neunmalschlaue“ Elfriede Jelinek, „für die gut und böse fein säuberlich sortiert sind“. Sehr abgeschmackt. Dafür singt er wohlfeile Loblieder auf Frank Castorf und dessen Berliner Volksbühne, gewissermaßen die Meistwertbude des deutschen Theaters.
Wen Küveler außerdem noch mag: Milo Rau, Antú Romero Nunes und den Shooting-Star Ersan Mondtag. Wobei er lobend hervorhebt, dass Nunes Nike-Sneakers trägt und Mondtag eine Adorno-Brille. Regie-Youngsters im Retro-Look! Na dann steht der Zukunft des Theaters ja nichts mehr im Wege.
Jan Küveler: Theater hassen. Tropen Verlag, Stuttgart 2016. 160 Seiten, 12 Euro. E-Book 9,99 Euro.
Witzig schreiben kann er ja,
der Kollege, nur tut er es gerne
ohne einen genaueren Blick
Wer das Theater hasst, fühlt sich von diesem schnell mal angeschmiert. Szene aus „Ach, Volk, du obermieses“ von und mit Jürgen Kuttner an der Berliner Volksbühne – ein Theater, das selbst Theaterhasser Jan Küveler liebt.
Foto: Thomas Aurin
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»So mitreißend und klug und dramatisch und überraschend und temperamentvoll wie das Theater selbst in seinen guten Momenten.« Niklas Maak, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 27.11.2016 »Er nennt das Theater ein "Geisterhaus toter Avantgarden", verlogen, langweilig, selbstgefällig und feige. Ich küsse seine Füße, denn er hat Recht und tut, was ein Kritiker tun muss: Er spricht die bittere Wahrheit aus.« Uwe Wittstock, Focus, 1.10.2016 »So ist seine Streitschrift auch ein zorniger Streifzug durch die jüngere Theatergeschichte und gibt natürlich bald zu erkennen, dass es dem Theaterhasser eigentlich um die Liebe geht, um seine Leidenschaft für ein Theater, das nicht posiert, nicht behauptet, keinen Moden, Schulen, Ideologien folgt, sondern intelligent, unterhaltsam, mutig und vor allem mit künstlerischer Sturheit und ästhetischem Eigensinn nach neuen Ausdrucksweisen für die Bühne tastet.« Dorothee Krings, rp-online.de, 21.12.2016 »Jan Küvelers Buch "Theater hassen" ist kurzweilig und klug, man bekommt auf leichtfüßige Art und Weise die wichtigsten Diskurse der Gegenwart erklärt.« Profil, 7.11.2016 , -