Magazinrundschau
Festverzinsliche Wertpapiere des Erinnerungsmarktes
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
17.02.2009. Brauchen die Palästinenser mehr Platz als die Belgier? fragt Amos Oz im Guardian. In Eurozine erklärt Slavenka Drakulic, wie man auf die harte Tour lernt. In Nepszabadsag beklagen der Pole Bogdan Goralczyk und der Ungar Laszlo Lengyel die Provinzialität Osteuropas. Im Espresso wirft Umberto Eco mit Büchern. Im TLS erklärt Richard Dawkins: Evolution ist wahr. The New Republic fürchtet die Zwei-Klassen Informationsgesellschaft nach dem Tod der Zeitungen.
Guardian (UK), 14.02.2009
 Aida Edemariam hat den israelischen Schriftsteller Amos Oz zwei Wochen vor den Wahlen in Jerusalem besucht und mit ihm über eine Zweistaatenlösung gesprochen. "'Die Voraussetzung für Frieden', sagt er, 'ist eine umfassende Lösung für das palästinensische Flüchtlingsproblem auf dem Boden eines zukünftigen Palästinas' - das er in der Westbank und Gaza sieht, verbunden durch einen Korridor oder unterirdischen Tunnel und befreit von fast allen israelischen Siedlungen. 'Und ich würde darauf beharren, das dies meine elementare Anforderung aus Eigennutz ist - aus Sicherheitsgründen für Israel. So lange diese Menschen unter unmenschlichen Bedingungen in Flüchtlingscamps verrotten, wird Israel nicht sicher sein, Friedensvertrag hin oder her.' Palästinenser wie der Schriftsteller Samir el-Youssef, der einem Flüchtlingscamp aufgewachsen ist, sehen die Dinge etwas anders. 'Oz sieht die Palästinenser als Problem an, das die Israelis so schnell wie möglich los werden sollten', sagt er. 'Seine lächerliche Vorstellung, dass alle Palästinenser sich auf dem winzigen Gebiet der West Bank und Gaza zusammendrängen, zeigt, dass er die Palästinenser nur als alte Möbel ansieht, die eingelagert werden müssen.' Oz' Antwort ist kurz: 'Wenn der letzte palästinensische Flüchtling auf der Westbank oder in Gaza angesiedelt ist, wäre es immer noch weniger überfüllt als Belgien.'"
Aida Edemariam hat den israelischen Schriftsteller Amos Oz zwei Wochen vor den Wahlen in Jerusalem besucht und mit ihm über eine Zweistaatenlösung gesprochen. "'Die Voraussetzung für Frieden', sagt er, 'ist eine umfassende Lösung für das palästinensische Flüchtlingsproblem auf dem Boden eines zukünftigen Palästinas' - das er in der Westbank und Gaza sieht, verbunden durch einen Korridor oder unterirdischen Tunnel und befreit von fast allen israelischen Siedlungen. 'Und ich würde darauf beharren, das dies meine elementare Anforderung aus Eigennutz ist - aus Sicherheitsgründen für Israel. So lange diese Menschen unter unmenschlichen Bedingungen in Flüchtlingscamps verrotten, wird Israel nicht sicher sein, Friedensvertrag hin oder her.' Palästinenser wie der Schriftsteller Samir el-Youssef, der einem Flüchtlingscamp aufgewachsen ist, sehen die Dinge etwas anders. 'Oz sieht die Palästinenser als Problem an, das die Israelis so schnell wie möglich los werden sollten', sagt er. 'Seine lächerliche Vorstellung, dass alle Palästinenser sich auf dem winzigen Gebiet der West Bank und Gaza zusammendrängen, zeigt, dass er die Palästinenser nur als alte Möbel ansieht, die eingelagert werden müssen.' Oz' Antwort ist kurz: 'Wenn der letzte palästinensische Flüchtling auf der Westbank oder in Gaza angesiedelt ist, wäre es immer noch weniger überfüllt als Belgien.'"Außerdem: Keith Thomas hat in der van-Dyck-Ausstellung in der Tate Britain gelernt, wieviel die britische Porträtmalerei - vor allem was Kostüme, Kinder und Hunde angeht - dem niederländischen Maler verdankt. (Wir lernen außerdem, dass die Engländer eine Geliebte früher 'lemon' nannten.) "Le Corbusier famously built nothing in Britain", aber er hat doch einige britische Architekten beeinflusst, erzählt Brian Dillon, der Isi Metzsteins und Andrew MacMillans verfallendes St. Peter College im schottischen Cardross besucht hat, das von Corbusiers Kapelle in Ronchamp inspiriert ist. Sanjay Subrahmanyam, Historiker an der kalifornischen UCLA, liest noch einmal - nicht unfreundlich, aber kritisch - Salman Rushdies "Satanische Verse".
Eurozine (Österreich), 06.02.2009
 Für Serben ist es sehr schwierig, ein Visum für Reisen in EU-Länder zu bekommen. Darüber beklagte sich kürzlich auf einer Diskussion ein junger Serbe, der ärgerlich fragte: Warum bestraft man die Jungen für etwas, dass sie nicht getan haben? Die kroatische Autorin Slavenca Draculic antwortet: "Ich fand nicht, dass er Recht hatte. Wie wir [die ihre Väter nicht gefragt haben, was sie im Zweiten Weltkrieg getan hatten], ist auch seine Generation verantwortlich: für ihr Schweigen, dass sie nicht fragen, was ihre Väter während der Kriege getan haben, für ihren Glauben, sie hätten ein Recht auf Visa, nur weil sie jung sind, ihre Hände sauber und ihre Arroganz gerecht. Vor allem sind sie dafür verantwortlich, dass sie ihre Eltern nicht fragen, warum die keine Visa bekommen. Sicher, die junge Generation der Serben kann nicht für die Vergangenheit verantwortlich gemacht werden. Aber sie alle sind verantwortlich für ihre Einstellung zur Vergangenheit, denn das ist wichtig für ihre Zukunft. Das ist die Lektion, die schon wir, die Generation ihrer Eltern, hätten lernen sollen. Weil wir sie nicht beizeiten gelernt haben, mussten wir sie auf die harte Tour lernen."
Für Serben ist es sehr schwierig, ein Visum für Reisen in EU-Länder zu bekommen. Darüber beklagte sich kürzlich auf einer Diskussion ein junger Serbe, der ärgerlich fragte: Warum bestraft man die Jungen für etwas, dass sie nicht getan haben? Die kroatische Autorin Slavenca Draculic antwortet: "Ich fand nicht, dass er Recht hatte. Wie wir [die ihre Väter nicht gefragt haben, was sie im Zweiten Weltkrieg getan hatten], ist auch seine Generation verantwortlich: für ihr Schweigen, dass sie nicht fragen, was ihre Väter während der Kriege getan haben, für ihren Glauben, sie hätten ein Recht auf Visa, nur weil sie jung sind, ihre Hände sauber und ihre Arroganz gerecht. Vor allem sind sie dafür verantwortlich, dass sie ihre Eltern nicht fragen, warum die keine Visa bekommen. Sicher, die junge Generation der Serben kann nicht für die Vergangenheit verantwortlich gemacht werden. Aber sie alle sind verantwortlich für ihre Einstellung zur Vergangenheit, denn das ist wichtig für ihre Zukunft. Das ist die Lektion, die schon wir, die Generation ihrer Eltern, hätten lernen sollen. Weil wir sie nicht beizeiten gelernt haben, mussten wir sie auf die harte Tour lernen."Economist (UK), 13.02.2009
 Zu den Vorteilen einer weltoffenen Zeitschrift, wie der Economist so exemplarisch eine ist, gehört, dass sie auch einen Korrespondenten in Sidney hat, der dort Cate Blanchett auf der Bühne erleben kann, und zwar in einer offenbar sehr interessanten Inszenierung: "Es ist inzwischen ziemlich normal, dass Filmstars auf den Bühnen des Londoner Westend oder am Broadway auftreten, aber Blanchetts Auftritt in Sidney ist doch nochmal etwas anderes: Sie spielt den König in Shakespeares 'Richard II.', im ersten Teil einer radikal verdichteten Version der acht Historien-Dramen. Cate Blanchett und ihr Ehemann, Andrew Upton, haben die künstlerische Leitung der Sydney Theatre Company übernommen, einer Organisation, die auf jeden Fall schon mal eine hohe Meinung von sich selbst hat. 'Wenn man überhaupt von einem australischen Nationaltheater sprechen kann, dann ist die Sydney Theatre Company dieses Nationaltheater', sagt Rob Brookman, der Manager der Truppe."
Zu den Vorteilen einer weltoffenen Zeitschrift, wie der Economist so exemplarisch eine ist, gehört, dass sie auch einen Korrespondenten in Sidney hat, der dort Cate Blanchett auf der Bühne erleben kann, und zwar in einer offenbar sehr interessanten Inszenierung: "Es ist inzwischen ziemlich normal, dass Filmstars auf den Bühnen des Londoner Westend oder am Broadway auftreten, aber Blanchetts Auftritt in Sidney ist doch nochmal etwas anderes: Sie spielt den König in Shakespeares 'Richard II.', im ersten Teil einer radikal verdichteten Version der acht Historien-Dramen. Cate Blanchett und ihr Ehemann, Andrew Upton, haben die künstlerische Leitung der Sydney Theatre Company übernommen, einer Organisation, die auf jeden Fall schon mal eine hohe Meinung von sich selbst hat. 'Wenn man überhaupt von einem australischen Nationaltheater sprechen kann, dann ist die Sydney Theatre Company dieses Nationaltheater', sagt Rob Brookman, der Manager der Truppe."In weiteren Artikeln geht es um den Zusammenschluss der Hollywood-Studios Dreamworks und Disney sowie, anlässlich der Vorstellung des Kindle 2, um die eher konservativen Benutzer der E-Books - die Technikaffinen lesen ohnehin, argumentiert der Verfasser, auf ihren iPhones. Besprochen werden unter anderem die Memoiren (Verlagsseite) des südafrikanischen Autors Andre Brink und David Reynolds' Geschichte Amerikas in einem Band (Verlagsseite),
Außerdem zeigt sich, in der Titelgeschichte, der Economist bitter enttäuscht von den ökonomischen Plänen Barack Obamas.
Nouvel Observateur (Frankreich), 12.02.2009
 Die iranische Revolution feiert ihren 30. Geburtstag, und nie zuvor war die Kluft zwischen Regime und Jugend größer als heute. Das jedenfalls ist das Fazit einer soziologischen Studie, die der Iran- und Religionsexperte Farhad Khoskrokhavar in Teheran, Gazvin und der heiligen Stadt Ghom durchgeführt hat. Sogar in letzterer, in der sich alles um islamische Gesetze dreht, engagiere sich ein großer Teil der Jugendlichen, wenn auch vorsichtig und heimlich, in einer Bewegung zur Säkularisation. Im Gespräch erklärt er: "Sie versuchen, sich aus Religion und Privatem eine heikle und eigenständige Kombination zu basteln. (...) Unsere Untersuchung zeigt, dass das Regime bei den Jugendlichen zugleich erfolgreich war und scheiterte. Erfolg hatte es insofern, als der Islam in seiner schiitischen Version zum Grundpfeiler der iranischen Identität wurde. Hingegen konnte die Jugend eine echte Distanz zwischen sich und dem Klerus schaffen, dem es nicht gelungen ist, sie geistig rekrutieren. Selbst in einer traditionsverhafteten und konservativen Stadt wie Ghom stößt man auf eine Infragestellung der Politik in ihrer theokratischen Form."
Die iranische Revolution feiert ihren 30. Geburtstag, und nie zuvor war die Kluft zwischen Regime und Jugend größer als heute. Das jedenfalls ist das Fazit einer soziologischen Studie, die der Iran- und Religionsexperte Farhad Khoskrokhavar in Teheran, Gazvin und der heiligen Stadt Ghom durchgeführt hat. Sogar in letzterer, in der sich alles um islamische Gesetze dreht, engagiere sich ein großer Teil der Jugendlichen, wenn auch vorsichtig und heimlich, in einer Bewegung zur Säkularisation. Im Gespräch erklärt er: "Sie versuchen, sich aus Religion und Privatem eine heikle und eigenständige Kombination zu basteln. (...) Unsere Untersuchung zeigt, dass das Regime bei den Jugendlichen zugleich erfolgreich war und scheiterte. Erfolg hatte es insofern, als der Islam in seiner schiitischen Version zum Grundpfeiler der iranischen Identität wurde. Hingegen konnte die Jugend eine echte Distanz zwischen sich und dem Klerus schaffen, dem es nicht gelungen ist, sie geistig rekrutieren. Selbst in einer traditionsverhafteten und konservativen Stadt wie Ghom stößt man auf eine Infragestellung der Politik in ihrer theokratischen Form."Aude Lancelin feiert das vierzigjährige Bestehen der Experimental-Universität Vincennes, in der Studenten und Professoren auf Augenhöhe miteinander arbeiteten und deren Dozentenliste sich wie ein Who?s who der französischen Geistes- und Sozialwissenschaften liest; hier lehrten unter anderem Gilles Deleuze und Felix Guattari, Jacques Lacan, Michel Foucault und Jean-Francois Lyotard sowie Antonio Negri. Am 18 März wird bei Flammarion die von Jean-Michel Dijan herausgegebene Publikation "Vincennes - Une aventure de la pensee critique" erscheinen.
Weltwoche (Schweiz), 12.02.2009
 Malte Hertwig hat in der NSDAP-Mitgliederkartei im Bundesarchiv in Berlin eine Mitgliedskarte von Hans Werner Henze gefunden. Ein unterschriebener Aufnahmeantrag liegt nicht vor. Ob der 1926 geborene Komponist, den Antrag selbst gestellt hat (er bestreitet das), weiß Hertwig nicht. In seinem Artikel, in dem viel von "verdrängter Vergangenheit" die Rede ist, hält er es immerhin für möglich, dass Henzes Vater den Antrag gestellt hat. "Seinen Vater, den Lehrer Franz Henze (1898-1945), beschreibt der Komponist als überzeugten Nationalsozialisten, der für ihn, den homosexuellen, linkshändigen Außenseiter, zum Inbegriff des totalitären NS-Regimes wurde. 'Mein Hass auf den Vater', schreibt Henze in 'Musik und Politik', 'verschränkte sich mit dem Hass auf den Faschismus und übertrug sich auf die Nation der Soldaten, die mir als eine Nation von Vätern erschien.' Noch dreißig Jahre nach Franz Henzes Tod plagen den Sohn 'Magenkrämpfe bei Erinnerungen an den Vater, die nun unentwegt heraufkommen aus dem großen schwarzen Teich des Vergessens'."
Malte Hertwig hat in der NSDAP-Mitgliederkartei im Bundesarchiv in Berlin eine Mitgliedskarte von Hans Werner Henze gefunden. Ein unterschriebener Aufnahmeantrag liegt nicht vor. Ob der 1926 geborene Komponist, den Antrag selbst gestellt hat (er bestreitet das), weiß Hertwig nicht. In seinem Artikel, in dem viel von "verdrängter Vergangenheit" die Rede ist, hält er es immerhin für möglich, dass Henzes Vater den Antrag gestellt hat. "Seinen Vater, den Lehrer Franz Henze (1898-1945), beschreibt der Komponist als überzeugten Nationalsozialisten, der für ihn, den homosexuellen, linkshändigen Außenseiter, zum Inbegriff des totalitären NS-Regimes wurde. 'Mein Hass auf den Vater', schreibt Henze in 'Musik und Politik', 'verschränkte sich mit dem Hass auf den Faschismus und übertrug sich auf die Nation der Soldaten, die mir als eine Nation von Vätern erschien.' Noch dreißig Jahre nach Franz Henzes Tod plagen den Sohn 'Magenkrämpfe bei Erinnerungen an den Vater, die nun unentwegt heraufkommen aus dem großen schwarzen Teich des Vergessens'."Nur im Print: Ein Interview mit Wolf Biermann.
Al Ahram Weekly (Ägypten), 12.02.2009
 Amr Hamzawy vom Carnegie Endowment for International Peace stinkt es langsam, dass in der arabischen Welt jede Kritik an der Hamas niedergebrüllt wird. Kritik, so werde gern argumentiert, "bezeuge eine ungesunde Abspaltung vom religiösen und nationalen Konsens und wird bestenfalls als intellektuelle Frivolität angesehen, die auf später verschoben werden müsse. Diese Einstellung ist gefährlich, denn sie birgt die totalitäre Implikation, den Gebrauch des Verstands und die freie Meinungsäußerung zu verbieten, sobald die Hamas und ihre Taten angesprochen werden. Die Araber leiden seit langem an den Folgen dieser Art des Schweigens. Nachdem sie der Hamas ein Zertifikat ausgestellt haben, das sie von jeder Verantwortung für den Krieg in Gaza freispricht und eine rationale Untersuchung der Entscheidungen und Taten der Bewegung verhindert haben, bestehen die Produzenten der Widerstandserzählung auf eine Art von Ausnahme, die die Freiheit der Gedanken und das Recht zu differenzieren unterminiert."
Amr Hamzawy vom Carnegie Endowment for International Peace stinkt es langsam, dass in der arabischen Welt jede Kritik an der Hamas niedergebrüllt wird. Kritik, so werde gern argumentiert, "bezeuge eine ungesunde Abspaltung vom religiösen und nationalen Konsens und wird bestenfalls als intellektuelle Frivolität angesehen, die auf später verschoben werden müsse. Diese Einstellung ist gefährlich, denn sie birgt die totalitäre Implikation, den Gebrauch des Verstands und die freie Meinungsäußerung zu verbieten, sobald die Hamas und ihre Taten angesprochen werden. Die Araber leiden seit langem an den Folgen dieser Art des Schweigens. Nachdem sie der Hamas ein Zertifikat ausgestellt haben, das sie von jeder Verantwortung für den Krieg in Gaza freispricht und eine rationale Untersuchung der Entscheidungen und Taten der Bewegung verhindert haben, bestehen die Produzenten der Widerstandserzählung auf eine Art von Ausnahme, die die Freiheit der Gedanken und das Recht zu differenzieren unterminiert."Außerdem: Die beste Aufführung beim diesjährigen Creative Forum for Independent Theatre Groups war die "Iphigenie in Aulis", inszeniert vom Gardzienice Theaters, schreibt Nehad Selaiha, die die polnische Truppe schon mal 1996 in Kairo gesehen hat, mit der "Carmina Burana".
Nepszabadsag (Ungarn), 14.02.2009
 Nepszabadsag veröffentlichte ein Gespräch zwischen dem polnischen Publizisten und Diplomaten Bogdan Goralczyk und dem ungarischen Politologen Laszlo Lengyel. Beide warfen einen Blick zurück auf zwei Jahrzehnten Nachwendezeit, die, so sehen es beide Intellektuelle, bei weitem nicht als Erfolg gewertet werden kann. Bogdan Goralczyk findet vor allem die ideologische, politische, mentale und materielle Polarisierung in den postkommunistischen Gesellschaften auffällig: "Das Schlimmste ist, dass wir immer noch lieber zurück schauen, als nach vorn zu blicken. Anstatt unser Zukunftsbild klar aufzuzeichnen und unser Programm in einem gemeinsamen Europa zu formulieren, ziehen wir uns in die eigene Provinzialität zurück und schneidern alles auf den eigenen Horizont zu. Das ist der Grund, weshalb die mitteleuropäische Kooperation nicht funktioniert. [...] Welchen Ausweg ich aus dieser Situation sehe? Dem Anschein zum Trotz einen ausgesprochen einfachen: Mehr Europa, mehr Empathie für die Nachbarn, mehr ruhige Dialoge unter einander. Ich befürchte, daß wir nicht einmal dieses Minimalprogramm werden absolvieren können. Wäre ich nur ein schlechter Prophet...!"
Nepszabadsag veröffentlichte ein Gespräch zwischen dem polnischen Publizisten und Diplomaten Bogdan Goralczyk und dem ungarischen Politologen Laszlo Lengyel. Beide warfen einen Blick zurück auf zwei Jahrzehnten Nachwendezeit, die, so sehen es beide Intellektuelle, bei weitem nicht als Erfolg gewertet werden kann. Bogdan Goralczyk findet vor allem die ideologische, politische, mentale und materielle Polarisierung in den postkommunistischen Gesellschaften auffällig: "Das Schlimmste ist, dass wir immer noch lieber zurück schauen, als nach vorn zu blicken. Anstatt unser Zukunftsbild klar aufzuzeichnen und unser Programm in einem gemeinsamen Europa zu formulieren, ziehen wir uns in die eigene Provinzialität zurück und schneidern alles auf den eigenen Horizont zu. Das ist der Grund, weshalb die mitteleuropäische Kooperation nicht funktioniert. [...] Welchen Ausweg ich aus dieser Situation sehe? Dem Anschein zum Trotz einen ausgesprochen einfachen: Mehr Europa, mehr Empathie für die Nachbarn, mehr ruhige Dialoge unter einander. Ich befürchte, daß wir nicht einmal dieses Minimalprogramm werden absolvieren können. Wäre ich nur ein schlechter Prophet...!"Laszlo Lengyel ist noch pessimistischer. "Bedenke nur lieber Bogdan, wie viele 'politische Generationen', wie viele unterschiedliche politischen Kulturen und Stile in den USA seit 1989 erschienen sind, im Vergleich zu Ungarn oder Polen! Die politische Elite hat ihren eigenen potentiellen Nachschub abgeblockt, neuen Gesichtern, Ideen und Institutionen den Zugang verwehrt. Die parlamentarische Demokratie ist ein Schein. Die unmittelbare Abhängigkeit von den Oberen, von der Parteizentrale, von dem Ministerpräsidenten, das feudale Günstlingssystem, die Verteilung und der Entzug der politischen Güter wurde erneut ausgebaut. Worin ihr am meisten an die Welt von Gomulka und Gierek, und wir an die Welt von Kadar erinnern, ist der vollkommene Antidemokratismus der politischen Selektion. Während der Systemwechsel und die Europäisierung von den Akteuren in der Wirtschaft, der Kultur und sogar von den Arbeitnehmern ernsthafte Anstrengung und Anpassungsfähigkeit abverlangte, forderte sie von der polnischen und ungarischen politischen Elite genau das Gegenteil - die Provinzialisierung. Unsere Führer sind alles andere als internationale Politiker. Sie sprechen ihre eigene, nationale Wählersprache, selbst wenn sie sie wortgetreu aus dem Englischen übersetzen"
Espresso (Italien), 13.02.2009
 Umberto Eco sorgt sich um unser kulturelles Gedächtnis und fährt bei seinen Büchern lieber zweigleisig. "Ich bin kein Ewiggestriger. Auf einer tragbaren Festplatte von 250 Gigabyte habe ich die Meisterwerke der Weltliteratur und die Geschichte der Philosophie gespeichert: es ist viel angenehmer, dort in wenigen Sekunden ein Zitat von Dante oder aus der 'Summa Theologica' herauszusuchen als aufstehen und einen schweren Band aus viel zu hohen Regalen wuchten zu müssen. Trotzdem bin ich froh, dass diese Bücher weiterhin in meinen Regalen stehen, sie sind eine Erinnerungsgarantie, falls die elektronischen Apparate einmal über den Jordan gehen." Bücher sind die festverzinslichen Wertpapiere des Erinnerungsmarktes, meint Eco. "Wenn ich meinen Computer oder mein E-Book aus dem fünften Stock schmeiße, kann ich todsicher sein, dass alles verloren ist. Ein Buch bekommt höchstens einen Knick."
Umberto Eco sorgt sich um unser kulturelles Gedächtnis und fährt bei seinen Büchern lieber zweigleisig. "Ich bin kein Ewiggestriger. Auf einer tragbaren Festplatte von 250 Gigabyte habe ich die Meisterwerke der Weltliteratur und die Geschichte der Philosophie gespeichert: es ist viel angenehmer, dort in wenigen Sekunden ein Zitat von Dante oder aus der 'Summa Theologica' herauszusuchen als aufstehen und einen schweren Band aus viel zu hohen Regalen wuchten zu müssen. Trotzdem bin ich froh, dass diese Bücher weiterhin in meinen Regalen stehen, sie sind eine Erinnerungsgarantie, falls die elektronischen Apparate einmal über den Jordan gehen." Bücher sind die festverzinslichen Wertpapiere des Erinnerungsmarktes, meint Eco. "Wenn ich meinen Computer oder mein E-Book aus dem fünften Stock schmeiße, kann ich todsicher sein, dass alles verloren ist. Ein Buch bekommt höchstens einen Knick." Times Literary Supplement (UK), 13.02.2009
Wenn überhaupt etwas wahr ist auf dieser Welt, dann ist es die Evolution, befindet der Biologe Richard Dawkins. In einem bissigen Artikel tritt der Autor kreationistischen und islamischen Weltbildern entgegen und zeigt sich begeistert von Jerry Coynes Buch "Why Evolution is true": "Woher kommt das oft nachgeplapperte Gerücht, 'Evolution sei nur eine Theorie'? Vielleicht von einem Missverständnis der Philosophen, die behaupten, dass Wissenschaft niemals die Wahrheit beweisen kann. Sie könne allenfalls eine Hypothese nicht widerlegen. ... Evolution ist wahr, in dem Sinne, dass man akzeptiert, dass Neuseeland in der südlichen Hemisphäre liegt. Wenn wir es ablehnen würden, ein Wort wie 'wahr' zu benutzen, wie könnten wir unsere alltäglichen Unterhaltungen führen? Oder einen Fragebogen ausfüllen: 'Was ist Ihr Geschlecht?' 'Die Hypothese, dass ich männlich bin, ist noch nicht widerlegt, aber lassen Sie mich das noch einmal überprüfen.' ... In diesem Sinne ist Evolution wahr - vorausgesetzt natürlich, dass das wissenschaftliche Beweismaterial überzeugend ist. Es ist sehr überzeugend, und Professor Coyne unterbreitet es uns auf eine Weise, dass kein objektiver Leser umhin könnte, es zwingend zu finden."
Gazeta Wyborcza (Polen), 14.02.2009
Im Interview spricht der polnische Schriftsteller Stefan Chwin über das bei Grabungsarbeiten entdeckte Massengrab in Malbork (dem früheren Marienburg), in dem möglicherweise mehr als 2.000 Deutsche verscharrt wurden, die in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs getötet wurden (über die verschiedenen Spekulationen zu diesem Zeitpunkt mehr hier und hier). Was Chwin den Stadtoberen von Malbork raten würde, die die Sache gern runterkochen würden? "Ich würde raten, diese Angelegenheit sofort in die Hände von Archäologen, Historikern und Anthropologen zu übergeben, und dann diese gefundenen Gebeine zu bestatten. Und ich finde, dies sollte kein Massengrab sein, also eine einzige riesige Grube, in die man alle menschlichen Überreste schüttet. Ich weiß, dass es schwer ist, zeitintensiv und arbeitsaufwändig, aber man hat auch nach den furchtbaren Gemetzeln auf den Balkan, sogar in Srebrenica, versucht die sterblichen Überreste irgendwie zu identifizieren."
Tadeusz Sobolewski erwartete sich von Andrzej Wajdas Film "Tatarak" einen Gegenakzent zur überpolitischen Berlinale: "Der Premiere wurde mit großen Hoffnungen entgegen geblickt, zumal 'Tatarak' sich gegen die programmatische Tendenz des Festivals stellt, welche dieses Jahr keine guten Filme hervorbrachte. Wajda, der hier eine Legende ist, beschäftigt sich weder mit der Krise, noch mit der Globalisierung. Er öffnet sich vor dem Publikum als Künstler."
Außerdem: Zu lesen ist Volker Schlöndorffs Rede im Rahmen der "Berliner Lektionen"; gelobt wird die Biografie des Regisseurs Kazimierz Kutz, dem Adam Michnik zudem im Namen all seiner Verehrer zum Achtzigsten gratuliert: "Schwer zu glauben, dass Schlesiens schwarze Erde einen so bunten und wunderschönen Vogel hervorgebracht hat".
Tadeusz Sobolewski erwartete sich von Andrzej Wajdas Film "Tatarak" einen Gegenakzent zur überpolitischen Berlinale: "Der Premiere wurde mit großen Hoffnungen entgegen geblickt, zumal 'Tatarak' sich gegen die programmatische Tendenz des Festivals stellt, welche dieses Jahr keine guten Filme hervorbrachte. Wajda, der hier eine Legende ist, beschäftigt sich weder mit der Krise, noch mit der Globalisierung. Er öffnet sich vor dem Publikum als Künstler."
Außerdem: Zu lesen ist Volker Schlöndorffs Rede im Rahmen der "Berliner Lektionen"; gelobt wird die Biografie des Regisseurs Kazimierz Kutz, dem Adam Michnik zudem im Namen all seiner Verehrer zum Achtzigsten gratuliert: "Schwer zu glauben, dass Schlesiens schwarze Erde einen so bunten und wunderschönen Vogel hervorgebracht hat".
HVG (Ungarn), 14.02.2009
 Die seitens der ungarischen Akademie der Wissenschaften, MTA, lang ersehnte Änderung des sogenannten Akademiegesetzes wird derzeit im ungarischen Parlament verhandelt und aller Voraussicht nach auch ratifiziert. Der Bauingenieur Istvan Polonyi ist allerdings skeptisch angesichts dieser Ausweitung der Befugnisse und der Autonomie der Akademie: "Nicht ein Akademiegesetz muss her, sondern eines über die Wissenschaft in Ungarn und deren Institutionenstruktur, die noch lange nicht mit der Akademie identisch ist, wenngleich diese sich in der Rolle des alleinigen Vertreters der Wissenschaft sehr gefällt. Schade, dass es unserer politischen Elite noch nicht aufgefallen ist, dass es in keinem fortschrittlichen Land dieser Welt eine Akademie gibt, die unserer gleichen würde, die - als Überbleibsel stalinistischer Wissenschaftsorganisation - die Repräsentation der Wissenschaft für sich beansprucht und als Quasi-Wissenschaftsministerium fungiert."
Die seitens der ungarischen Akademie der Wissenschaften, MTA, lang ersehnte Änderung des sogenannten Akademiegesetzes wird derzeit im ungarischen Parlament verhandelt und aller Voraussicht nach auch ratifiziert. Der Bauingenieur Istvan Polonyi ist allerdings skeptisch angesichts dieser Ausweitung der Befugnisse und der Autonomie der Akademie: "Nicht ein Akademiegesetz muss her, sondern eines über die Wissenschaft in Ungarn und deren Institutionenstruktur, die noch lange nicht mit der Akademie identisch ist, wenngleich diese sich in der Rolle des alleinigen Vertreters der Wissenschaft sehr gefällt. Schade, dass es unserer politischen Elite noch nicht aufgefallen ist, dass es in keinem fortschrittlichen Land dieser Welt eine Akademie gibt, die unserer gleichen würde, die - als Überbleibsel stalinistischer Wissenschaftsorganisation - die Repräsentation der Wissenschaft für sich beansprucht und als Quasi-Wissenschaftsministerium fungiert."New Statesman (UK), 16.02.2009
 Die Oscars brauchen eine gründliche Überholung, meint Ryan Gilbey, der nicht nur angesichts der diesjährigen Nominierungen den Eindruck hat, dass die Academy die Entwicklungen in den letzten fünfzig Jahren verpasst hat. Und er macht ein paar Vorschläge, zum Beispiel, mehr ausländische Filme aufzunehmen: "Nennen Sie es positive Diskriminierung oder affirmative action, aber ab sofort sollten die Nominierungen für den 'Besten Film' auf sechs erhöht werden, zwei davon müssen aus nicht englischsprachigen Ländern kommen. Man muss die Mitglieder der Academy dazu zwingen, Filme zu berücksichtigen, die nicht in ihrer lokalen Einkaufspassage gezeigt wurden. Anders ist es einfach nicht möglich, das Ungleichgewicht auszubalancieren. Lasst den 'Vorleser' gegen 'Waltz with Bashir' antreten und wir werden einige echte Tränen von Kate Winslet sehen."
Die Oscars brauchen eine gründliche Überholung, meint Ryan Gilbey, der nicht nur angesichts der diesjährigen Nominierungen den Eindruck hat, dass die Academy die Entwicklungen in den letzten fünfzig Jahren verpasst hat. Und er macht ein paar Vorschläge, zum Beispiel, mehr ausländische Filme aufzunehmen: "Nennen Sie es positive Diskriminierung oder affirmative action, aber ab sofort sollten die Nominierungen für den 'Besten Film' auf sechs erhöht werden, zwei davon müssen aus nicht englischsprachigen Ländern kommen. Man muss die Mitglieder der Academy dazu zwingen, Filme zu berücksichtigen, die nicht in ihrer lokalen Einkaufspassage gezeigt wurden. Anders ist es einfach nicht möglich, das Ungleichgewicht auszubalancieren. Lasst den 'Vorleser' gegen 'Waltz with Bashir' antreten und wir werden einige echte Tränen von Kate Winslet sehen."Nach drei Jahren quittiert Alice O'Keeffe ihren Job als Kunstkritikerin beim New Statesman. Es war eine bizarre Zeit, meint sie. "Die zeitgenössische Kunstszene bot ein sklavisch dem Geld dienendes Catering, weil sie ausschließlich die Reichen bediente. Da die Käufer oft keine Ahnung von Kunst hatten, gab es keine rationale Verbindung zwischen der Qualität eines Kunstwerks und seinem Preisschild."
Point (Frankreich), 12.02.2009
 Bernard-Henri Levy erinnert in seinen Bloc-notes an den 20. Jahrestag der gegen Salman Rushdie wegen seiner "Satanischen Verse" verhängten Fatwa. "Die Ayatollahs waren nicht die ersten, die Bücher verbrannt und Schriftsteller umgebracht haben? Gewiss. Und diese Verletzung der Sicherheit des Geistes ist jedes Mal eines der Warnsignale für einen Einzug ins Reich des Bösen. Die Affäre Rushdie war ein solcher Indikator. Sie hatte die Funktion, der alten Welt die Totenglocke zu läuten. Sie sollte eines dieser Ereignisse, wenn nicht das Ereignis gewesen sein, welches das Auftauchen einer neuen Variante des Faschismus, des Islamofaschismus markiert. Es gab den 11. September mit seinen drei Anschlägen... Den Tod von Massoud als Vorspiel... Das Martyrium von Daniel Pearl etwas später... Doch am Beginn dieser Reihe, so scheint mir rückblickend, steht plötzlich ganz eindeutig dieses Todesurteil für einen Schriftsteller wegen literarischer Beleidigung des Koran."
Bernard-Henri Levy erinnert in seinen Bloc-notes an den 20. Jahrestag der gegen Salman Rushdie wegen seiner "Satanischen Verse" verhängten Fatwa. "Die Ayatollahs waren nicht die ersten, die Bücher verbrannt und Schriftsteller umgebracht haben? Gewiss. Und diese Verletzung der Sicherheit des Geistes ist jedes Mal eines der Warnsignale für einen Einzug ins Reich des Bösen. Die Affäre Rushdie war ein solcher Indikator. Sie hatte die Funktion, der alten Welt die Totenglocke zu läuten. Sie sollte eines dieser Ereignisse, wenn nicht das Ereignis gewesen sein, welches das Auftauchen einer neuen Variante des Faschismus, des Islamofaschismus markiert. Es gab den 11. September mit seinen drei Anschlägen... Den Tod von Massoud als Vorspiel... Das Martyrium von Daniel Pearl etwas später... Doch am Beginn dieser Reihe, so scheint mir rückblickend, steht plötzlich ganz eindeutig dieses Todesurteil für einen Schriftsteller wegen literarischer Beleidigung des Koran."New Republic (USA), 04.03.2009
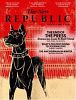 Paul Starr von der Princeton University analysiert in einem faktenreichen und im Ton angenehm sachlichen Artikel von epischer Länge die niederschmetternde Situation der Zeitungen in den USA. Um es gleich vorwegzunehmen: einen Lösungsvorschlag hat er nicht. Und doch "ist dies nicht die Zeit für Internettriumphalismus", schreibt er. Denn das Internet könnte statt eine breiter informierte allgemeine Öffentlichkeit auch eine Zwei-Klassen-Informationsgesellschaft herausbilden. Schon das Kabelfernsehen habe diesen Trend eingeleitet. "Wie [Markus] Prior uns in seinem Buch 'Post-Broadcast Democracy' erinnert, hatten die drei großen Fernsehsender in den frühen Jahrzehnten des Fernsehens bis in die 70er hinein eine praktisch gefangene Zuschauerschaft, weil sie die Abendnachrichten alle zur selben Zeit brachten. Obwohl viele Menschen nach der Arbeit vielleicht lieber ein Unterhaltungsprogramm gesehen hätten, haben sie die Nachrichten mit Walter Cronkite oder Chet Huntley und David Brinkley gesehen und etwas über Politik und Weltereignisse gelernt. Als Kabel- und Satellitenfernsehen entwickelt wurden, konnten die Zuschauer wählen. Laut Prior floh eine große Gruppe, etwa drei von zehn Zuschauern, von den Nachrichten zu Unterhaltungsprogrammen, während eine kleinere Gruppe, vielleicht einer von zehn, anfing, mehr Nachrichten und politische Dieskussionen zu verfolgen, weil sie jetzt Zugang zu Fox News, CNN und MSNBC hatten. Im Ergebnis, das zeigen Priors Zahlen, führte das zu einer steigenden Ungleichheit in politischem Wissen zwischen den Nachrichten-Drop-outs und den Nachrichten Junkies."
Paul Starr von der Princeton University analysiert in einem faktenreichen und im Ton angenehm sachlichen Artikel von epischer Länge die niederschmetternde Situation der Zeitungen in den USA. Um es gleich vorwegzunehmen: einen Lösungsvorschlag hat er nicht. Und doch "ist dies nicht die Zeit für Internettriumphalismus", schreibt er. Denn das Internet könnte statt eine breiter informierte allgemeine Öffentlichkeit auch eine Zwei-Klassen-Informationsgesellschaft herausbilden. Schon das Kabelfernsehen habe diesen Trend eingeleitet. "Wie [Markus] Prior uns in seinem Buch 'Post-Broadcast Democracy' erinnert, hatten die drei großen Fernsehsender in den frühen Jahrzehnten des Fernsehens bis in die 70er hinein eine praktisch gefangene Zuschauerschaft, weil sie die Abendnachrichten alle zur selben Zeit brachten. Obwohl viele Menschen nach der Arbeit vielleicht lieber ein Unterhaltungsprogramm gesehen hätten, haben sie die Nachrichten mit Walter Cronkite oder Chet Huntley und David Brinkley gesehen und etwas über Politik und Weltereignisse gelernt. Als Kabel- und Satellitenfernsehen entwickelt wurden, konnten die Zuschauer wählen. Laut Prior floh eine große Gruppe, etwa drei von zehn Zuschauern, von den Nachrichten zu Unterhaltungsprogrammen, während eine kleinere Gruppe, vielleicht einer von zehn, anfing, mehr Nachrichten und politische Dieskussionen zu verfolgen, weil sie jetzt Zugang zu Fox News, CNN und MSNBC hatten. Im Ergebnis, das zeigen Priors Zahlen, führte das zu einer steigenden Ungleichheit in politischem Wissen zwischen den Nachrichten-Drop-outs und den Nachrichten Junkies."Außerdem: Joe Mathews beklagt den journalistischen Niedergang der Los Angeles Times. Und Gabriel Sherman stellt das Nachrichtenmagazin Politico vor, das in der kurzen Zeit seines Bestehens die großen Zeitungen ins Schwitzen gebracht hat.
Kommentieren







