Im Kino
Beglaubigung des Messias
Die Filmkolumne. Von Thomas Groh, Michael Kienzl
01.03.2017. Martin Scorseses "Silence" führt in einer Ästhetik der Konzentration vor, wie man vom Glauben abfallen kann, ohne vom Glauben abzufallen. Kelly Reichhardt reicht in "Certain Women" manchmal bereits ein muffiger Pullunder, um das dramatische Potenzial ihrer Kleinstadt-Erzählung auszureizen.
Gott schweigt. Christen werden verbrannt, ertränkt, gefoltert, gekreuzigt, geköpft - und Gott schweigt sein eiskaltes Schweigen. Ein Schweigen, das als Glaubensprobe auf sich genommen wird: Wir befinden uns im Japan der Edo-Zeit, zur Zeit der "Kakure Kirishitan", der "heimlichen Christen", die (nach einer zunächst vorsichtig-friedlichen Phase erster Missionen) vor zunehmender Verfolgung ins innere, geheimbündlerische Exil flüchten. Gleich zu Beginn von "Silence" werden wir Zeuge eines (und beileibe nicht des letzten) sadistischen Massakers - die gequälten Christen, erfahren wir, verlangten nach der Folter, um die Stärke ihres Glaubens zu demonstrieren: Selbst in Momenten größter Pein würden sie den Akt der Apostasie, des formalen Abfalls vom Glauben, verweigern.
In seinem Kern ist das Christentum ein Todeskult. Zumindest aber ist es von einer sonderbaren Sehnsucht nach Tod und körperlichem Leid geprägt: Erst durch den gewaltsamen Tod Christi wird die Menschheit erlöst, noch in der flüchtigen Bekreuzigung als Ausweis des eigenen Glaubens steckt die Referenz an eines der brutalsten Folter- und Mordwerkzeuge der Antike. In der detaillierten Darstellung des geschundenen Jesus-Körpers offenbart sich in Zeiten der Religionskunst das Geschick des Künstlers. Die Wunde in Jesu Flanke, vom ungläubigen Thomas mit dem Finger betastet, dient zur Beglaubigung des wahrhaftigen Messias.
Dieses nicht immer restlos auflösbare Nahverhältnis zwischen Gewalt und religiöser Überzeugung schlägt sich auch im Kino der Drastik nieder: Nach diversen Skandalen rund um den Regisseur mittlerweile einigermaßen vergessen, illustrierte Mel Gibsons "Passion Christi" (2004) die christlich grundierte Schaulust am Gewaltexzess eindrücklich. Gerade erst kam Gibsons Comeback in die Kinos, "Hacksaw Ridge", der zur Veranschaulichung der christlichen Tiefenüberzeugung seines Protagonisten denselben im Stahlgewitter des Zweiten Weltkriegs als pazifistisch-waffenlosen Soldaten über Berge zermalmter Körper rennen lässt. Und mit knappem Abstand hinterher: Martin Scorseses auf Grundlage von Endō Shūsakus Roman "Schweigen" (1966) entstandener "Silence", ein seit vielen Jahren geplantes Herzensprojekt seines Regisseurs, ein Film über im Namen Christi erduldetes Leid unter Gottes schweigendem Blick.

Doch wo "Hacksaw Ridge" eine erbauliche Heldengeschichte erzählt (Mel Gibson ist glühender Christ), ist "Silence" eine Meditation über den Zweifel (Scorseses Verhältnis zur Religion ist on/off, aber als katholischer Agnostiker oder agnostischer Katholik ist er wohl ganz gut beschrieben). Damit bildet "Silence" vielleicht sogar so etwas wie ein Gegenstück zu Scorseses Vorgänger "The Wolf of Wall Street", in dem ein völlig von sich selbst besoffener Maniac zwei Stunden lang fröhliche Urständ' feiert. Auch die Tonlage ist kontrastiv hart: War "Wolf of Wall Street" ein wild wuchernder, koks-deliranter Exzess, der sich ständig selbst überbot, zieht "Silence" sich in Exerzitium, Andacht und Gebet zurück. Entsprechend besteht die musikalische Untermalung aus unauffälligem Ambient; über dem Abspann erklingt eine konzentrierte Naturgeräusch-Collage. Selbst noch in Momenten gröbster Gewalt ruht der Film in sich und orientiert sich an der Stasis religiöser Ikonen.
Dass Andrew Garfield sowohl in "Hacksaw Ridge", als auch in "Silence" die Hauptrolle spielt, rückt beide Filme noch ein Stück näher beisammen. Hier spielt er den portugiesischen Jesuiten Sebastião Rodrigues, der sich mit Francisco Garupe (Adam Driver) von Macau nach Japan begibt, wo der Kontakt zum Missionar Cristóvão Ferreira (Liam Neeson) seit geraumer Zeit und unter rätselhaften Bedingungen abgebrochen ist. Die Reise durch Japan gestaltet sich als eine entbehrungsreiche Reise in ein ganz eigenes Herz der Finsternis. Ohne Kenntnis über den Verbleib des einstigen Mentors, stößt Rodrigues auf vereinzelte christliche Konvertiten, die ihre Gastfreundschaft und religiöse Wissbegier alsbald unter den Augen des Jesuiten mit dem Leben bezahlen müssen. Es folgen Verrat, Gefangenschaft und schließlich die Begegnung mit Ferreira, der als eine Art pragmatischer Wiedergänger von General Kurtz aus "Apocalypse Now" seinen Frieden mit der japanischen Kultur gemacht hat und dem Glauben des jungen Rodrigues eine finale Bewährungsprobe stellt: Können religiöse Überzeugungen einen transkulturell-universalistischen Anspruch formulieren? Oder sind die Grundlagen einer Religion nicht immer schon an ihre jeweiligen Kulturen gebunden, Religion eine Gefangene im Haus der eigenen Sprache? Für Ferreira liegt die Sache auf der Hand: Eine Kultur wie die japanische, die in Form der Sonne einen ihrer Götter täglich vor Augen stehen hat und ihre religiösen Begriffe aus der sie umgebenden Natur schöpft, sei für den abstrakten Gott der Monotheisten und deren Konzept einer transzendentalen Metaphysik schlicht nicht empfänglich.
Leicht hätte Scorsese aus "Silence" einen grimmig-raunenden Großfilm machen können - tatsächlich fühlt sich die erste halbe Stunde sehr danach an. Durch die ersten Minuten mit christlichem Voice-Over, vielsagenden Überblendungen aufs Jesu-Konterfei und mystisch anmutenden Naturbildern muss man durch. Allerdings ist diese Darstellung einer tief vom Glauben durchseelten Welt nicht zu verwechseln mit dem tatsächlichen Anliegen Scorseses. Der Film mündet rasch ein in eine klar strukturierte Abfolge von Glaubensproben, die konkret verhandelt werden, ohne sich im formalästhetischen Hokuspokus zu verflüchtigen. Nicht, dass der Film nicht aufwändig gemacht wäre. Doch folgt er eher einer Ästhetik der Konzentration als einer Ästhetik der Kathedrale. Vielleicht auch deshalb war "Silence" bei den gerade verliehenen Oscars - von einer erfolglosen Nominierung für Kameramann Rodrigo Prieto abgesehen - merkwürdig unsichtbar.

Trotz seines meist gedämpften Auftretens ist Rodrigues eine typische Scorsese-Figur insofern, als sie hinter der Fassade von einem buchstäblich messianischem Größenwahn getrieben ist: Mit Bart und wallendem Haar hat Garfield ohnehin schon eine jesus-artige Anmutung, beim Blick in ein Gewässer erblickt Rodrigues dann tatsächlich den ikonischen Heiland im eigenen Gesicht. Anders als die gängigen Scorsese-Narzissten, die ihrer Umwelt skrupellos und oft in Form eruptiver Entladungen ihr Ego aufprägen, folgt Rodrigues einer gewaltsam aufgedrückten Reise in die innere Migration. Diese stellt eine Kasteiung des bildersüchtigen Katholizismus dar: Christliche Bilder und Symbole figurieren gegenständlich und prominent in "Silence". Am Umgang mit ihnen machen die japanischen Machthaber die erfolgte Apostasie fest: Immer wieder gibt es Szenen, in denen Konvertiten dazu gezwungen werden, christliche Bilder mit Füßen zu berühren.
Der Clou des Films besteht darin, dass Rodrigues lernt, vom Glauben abzufallen, ohne vom Glauben abzufallen. Die religiöse Sehnsucht des Menschen erkennt Scorsese ohne weiteres an - nur rät er dazu, Institutionen, Bilder und Rituale nicht mit religiöser Ekstase an sich zu verwechseln. Mit seiner Thematik des religiösen Antagonismus und den allgegenwärtigen abgeschlagenen Köpfen ist es verführerisch, "Silence" auch als Kommentar zu heutigen Konfliktstellungen zu begreifen. Folgt man dieser Lesart, plädiert Scorsese für eine authentisch-widerständige Glaubenserfahrung im Subjektiven, die allerdings keiner Entäußerungen mehr in Ritualen, Symbolen und anderer performativer Bekräftigungen mehr bedarf. Es geht um die Erkenntnis, dass ein Symbol nicht mit der Sache an sich zu verwechseln ist. Heute, da religiöse und weltanschauliche Eiferer Zulauf haben, nicht die schlechteste Erinnerung.
Thomas Groh
Silence - USA 2016 - Regie: Martin Scorsese - Darsteller: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciaran Hinds, Issei Ogata - Laufzeit: 161 Minuten.
---

"Certain Women" beginnt mit einem Zug, der an den Bergen Montanas vorbeifährt. Montana? Eigentlich hat sich die Amerikanerin Kelly Reichardt ihren filmischen Kosmos in Oregon eingerichtet. Ihre Arbeiten aus den letzten Jahren sind untrennbar mit der waldreichen Landschaft dort verbunden. Doch in ihrer neuesten Regiearbeit begibt sie sich zwei Bundesstaaten weiter, wo alles ein bisschen größer, weitläufiger und in seiner winterlichen Kargheit auch ein wenig trister aussieht. Der ratternde Güterzug, der eine ganze Weile braucht, bis er es vom Hinter- in den Vordergrund geschafft hat, stimmt einen nicht nur auf das gemächliche Tempo des Films ein, sondern gibt auch ein Gefühl für die Proportionen des immerhin viertgrößten Bundesstaates der USA. Die Kleinstädte wirken hier durch die endlose Weite noch ein bisschen mickriger, als sie es ohnehin schon sind.
Auch in den drei auf Kurzgeschichten der Autorin Maile Meloy basierenden Erzählungen von "Certain Women" spielt diese Weitläufigkeit eine nicht unerhebliche Rolle. Kristen Stewart hat etwa einen Auftritt als junge Anwältin, die an einer Abendschule Kurse für Erwachsene gibt. Für diesen Job muss sie vier Stunden hin und anschließend auch wieder zurück fahren. Ein Schicksal, dem man sich in einer derart lose besiedelten Gegend wohl fügen muss und das der Film nutzt, um zwei Schauplätze und drei Geschichten miteinander zu verbinden. Es gibt ein paar solcher kleiner Korrespondenzen - einen betrügenden Ehemann etwa oder eine Anwaltskanzlei - und dem Film gelingt es dadurch sehr elegant, seine Episoden zusammenzuhalten, ohne ihre erzählerische Freiheit zu beschneiden.
Stewarts Rolle ist keineswegs auf ihre Funktion als Bindeglied beschränkt. Bei ihren Gastspielen verzaubert sie nicht nur die einsame Farmerin Jamie (Lily Gladstone), sondern ist schon allein als Erscheinung eine Attraktion für sich. Sie sieht aus, als hätte sie die Kleidung ihrer Oma an: Einen dicken, senffarbenen Wollpullunder, bei dem es einen schon vom bloßen Hinschauen juckt und eine hochgezogene mom jeans, wie sie der hippe Nachwuchs schon seit einigen Jahren wieder salonfähig machen will. Stewart trägt diese Klamotten zwar mit Würde, aber selbst sie schafft es nicht, ihnen einen Hauch von vintage chic zu verpassen. Reichardt kann es sich erlauben, das dramatische Potenzial ihrer Erzählungen vollends auszureizen, weil sie einen Blick für solche Details hat. Ein muffiger Pullunder reicht schon aus, um zu zeigen, wie isoliert die Menschen in dieser Gegend sind.

"Certain Women" erzählt von drei Frauen, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander verbindet. Sie ringen mit ihrer Identität und ihrem Gewissen, bleiben dabei aber immer fest in ihrem Alltag verwurzelt. Reichardt erzählt das leise und zurückhaltend. Nachdem sie mit "Night Moves" zuletzt ihre Version eines straighten Genre-Films inszeniert hat, rückt sie diesmal wieder stärker an die Ränder konventioneller Narration. Ob bei der Anwältin Laura (Laura Dern), die sich mit einem renitenten Klienten herumplagen muss, oder der Ehefrau und Mutter Gina (Michelle Williams), die mit ihrer eingespielten Rolle als bad cop unzufrieden ist: Der Film nähert sich zwar konkreten Konflikten, bleibt dabei aber überwiegend ausschnitthaft. Auf der Filmdatenbank IMDb hat ein User seinen Kommentar zu "Certain Women" mit "Not entertaining - maybe I missed something" betitelt. Tatsächlich findet sich genau in diesem Gefühl, etwas Wesentliches verpasst zu haben, die Qualität des Films. Seine Figuren und die Gegend, in der sie leben, bringt er einem weniger über Zuspitzungen als über seine ständige Zerstreuung näher.
Ihre Figuren verdonnert Reichardt nicht dazu, bloße Repräsentantinnen einer sozialen Gruppe zu sein. Laura, Gina und Jamie sind unterschiedlich alt, befinden sich in verschiedenen Berufen und Lebenssituationen, aber keiner dieser Aspekte wird zur bestimmenden Charaktereigenschaft. Sicher, Frauen sind sie alle und "Certain Women" demonstriert auch, dass es mehr als nur ein feiner Unterschied ist, wenn man weniger ernst genommen wird als der Gatte oder ein männlicher Kollege. Aber der Film interessiert sich nur bedingt für den Geschlechterunterschied und legt stattdessen den Blick auf ein komplexes Geflecht gesellschaftlicher Hierarchien frei. Die kleinen Herabwürdigungen, die die Protagonistinnen erfahren, geben sie an anderer Stelle weiter. Aus der privilegierten Position eines Menschen mit besserer Bildung, Herkunft oder dem Glück der späten Geburt ist es ein Leichtes, den verzweifelten Arbeiter zu belächeln oder den senilen Nachbarn auszunutzen.
So brüchig wie die Figuren bleiben auch die Geschichten. Selbst in der vergleichsweise klassisch erzählten Episode um eine sich scheu anbahnende Liebe schafft sich Reichardt ihre Freiräume. Etwa mit Szenen, die in fast dokumentarischer Ausführlichkeit die harte Arbeit des Bauernlebens zeigen oder Jamies überstürzten Ausflug in die Kleinstadt Livingston. Mit einer Reihe poetisch ineinander fließender Nachtaufnahmen tut "Certain Women" schließlich das, womit man aufgrund seiner vermeintlich distanzierenden Ästhetik gar nicht gerechnet hätte: Der Film eignet sich den Blick des herumirrenden Mädchens an und verwandelt einen 7.000-Seelen-Ort mit Bildern von dunklen Gassen, Neon-Schildern und blank polierten Schaufenstern in einen regelrechten Großstadtdschungel. Es kommt eben auf die Proportionen an.
Michael Kienzl
Certain Women - USA 2016 - Regie: Kelly Reichhardt - Darsteller: Laura Dern, Michelle Williams, Lily Gladstone, Kristen Stewart, Jared Harris, James Le Gros - Laufzeit: 107 Minuten.
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens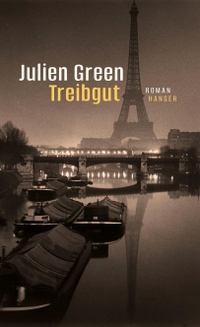 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut